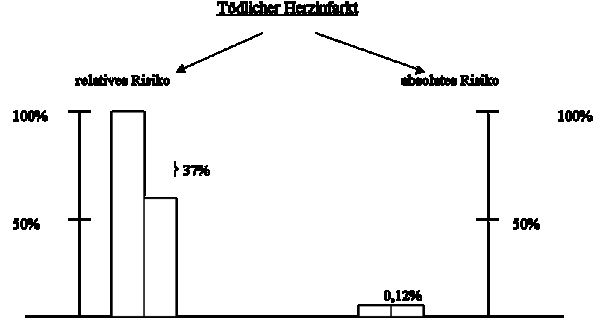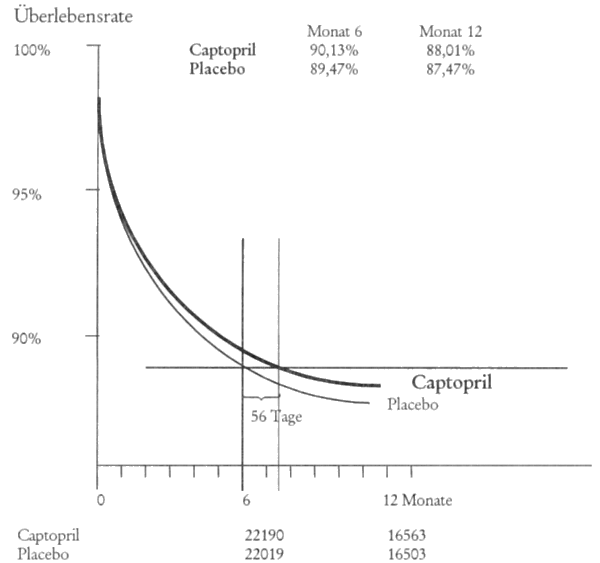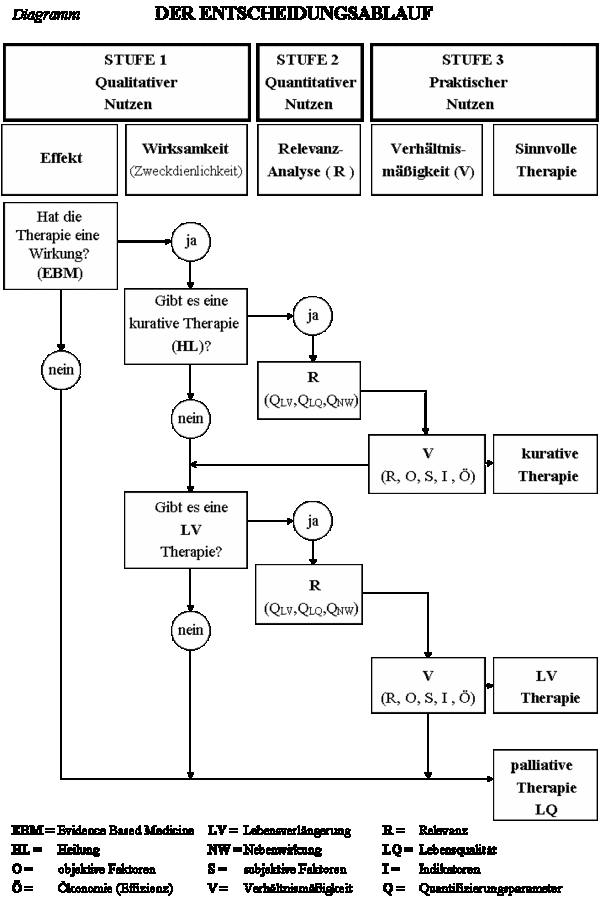Paradigmawechsel: Sinnorientierte Medizin
Zusammenfassung
Sinnorientierte Medizin (S.O.M.) soll zu einer richtigen und angemessenen Einschätzung moderner wissenschaftlicher Daten und zu einem gezielten Einsatz von diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen in der Praxis führen. Zur Entscheidungsfindung wird ein Stufenplan vorgestellt, anhand dessen die Sinnhaftigkeit von medizinischen Daten bzw. Maßnahmen für den Einzelfall gewichtet werden können: Wirksamkeits- und Relevanzanalyse. Ein meßbarer Effekt (Evidence Based Medicine) garantiert keineswegs, daß eine medizinische Maßnahme auch hilfreich ist. Immer muß auch abgewogen werden, ob der "Preis" (im weitesten Sinn, d.h. nicht nur materiell gemessen), der für eine Maßnahme in Kauf genommen werden muß, dem erreichbaren Erfolg angemessen ist (Prinzip Verhältnismäßigkeit). Hier spielen individuelle Präferenzen des jeweiligen Patienten eine große Rolle. So erst kann abgeschätzt werden, wie praktisch sinnvoll eine medizinische Maßnahme für den individuellen Einzelfall wirklich ist. Sinnorientierte Medizin ist patientengerechte Medizin.
Schlüsselwörter: Einschätzung wissenschaftlicher Daten, Sinnhaftigkeit, Verhältnismäßigkeit, patientengerechte Medizin
Abstract
Sense Oriented Medicine (S.O.M.) shall aim at a correct and reasonable evaluation of up-to-date scientific data as well as at a carefully directed application of diagnostic and therapeutic practical steps. For decision making, a step-by-step scheme is presented which makes it possible to weigh up how sensible (meaningful) medical data or applications may be in a specific case: by analysis of efficacy and relevance. A measurable effect (Evidence Based Medicine) in no way guarantees medical measures to be helpful. It is necessary to consider carefully whether the actual price (in the widest sense, i.e. not only in a material sense) which has to be put up with in a specific measure, is proportionate to the achievable success or not (Principle of Proportionality). Here the patients’ individual preferences are relevant. Thus it can be evaluated, how practically reasonable a medical measure in the individual case might really be. Sense Oriented Medicine is therefore very fair to the patient.
Keywords: evaluation of scientific data, sensible application, proportionality, fairness to patients
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. S.O.M. im Detail
1. Stufe 1: Der qualitative Nutzen
1.1 Effekt
1.2 Wirksamkeit (Zweckdienlichkeit)
2. Stufe 2: Der quantitative Nutzen - Relevanzanalyse
2.1 Quantifizierung der Lebensverlängerung
2.2 Quantifizierung der Lebensqualität
2.3 Quantifizierung der Nebenwirkungen
2.4 Ermittlung von Relevanz-Skalen
3. Stufe 3: Der praktische Nutzen - Verhältnismäßigkeitsanalyse
3.1 Individuelle Faktoren der Verhältnismäßigkeit
3.2 Der ökonomische Faktor: die Effizienz
4. Bewertungskriterien der Verhältnismäßigkeit
4.1 Verhältnismäßigkeitsindikatoren
4.2 Die Verhältnismäßigkeitsforschung
5. S.O.M. - Stufenplan
III. Nutzen der Sinnorientierten Medizin (S.O.M.)
Anhang: Abkürzungen
I. Einleitung
Die Faszination des Machbaren
Die Medizin hat in den letzten Jahren ungeheure Fortschritte erzielt.
Dieser Fortschritt basiert in erster Linie auf der konsequenten Nutzbarmachung von neuen Technologien zur Linderung von Leiden, auf Heilung von bis dahin unheilbaren Krankheiten und auf der Bewältigung von früher absolut tödlichen Krisen. Allerdings hat sich parallel dazu ein zweifelhafter Fortschrittsglaube breitgemacht, wonach der Mensch mit Hilfe seiner Vernunft die Zwecke der Natur selbst bestimmen und unter seine Herrschaft bringen kann. Freilich hat dieses Konzept in den letzten Jahrzehnten ein erstaunliches Phänomen hervorgebracht: die Faszination des Machbaren weist nämlich in bestimmten Bereichen eine Tendenz zur Verselbständigung auf, wodurch eine Abkoppelung des ärztlichen Tuns von dessen Sinnhaftigkeit droht. Das Machbare würde dann nicht mehr Mittel zum Ziel, sondern zum Selbstzweck und damit zum maßgeblichen Fortschrittskriterium bzw. Forschungsziel werden. Die Frage, ob eine Therapie dem Patienten auch hilft und daher sinnvoll ist, tritt in den Hintergrund.
Diese Mentalität wird in den letzten Jahren zunehmend in Frage gestellt. Die immer lauter werdenden Rufe nach einer "menschlichen Medizin", nach einem würdigen Sterben, die Debatte über einen gerechtfertigten oder ungerechtfertigten Behandlungsverzicht bzw. über die aktive und passive Euthanasie, die Angst vor der Apparatemedizin usw. sind Zeichen dieses Unbehagens.
Dazu kommen die ökonomischen Zwänge, durch die der Quantität des Machbaren zunehmend Grenzen gesetzt werden.
Die Machbarkeit als solche reicht als Rechtfertigungsgrund für die Handlungsentscheidung in Forschung und ärztlicher Praxis nicht aus. Es bahnt sich ein Paradigmawechsel bei der ärztlichen Entscheidungsfindung an, der erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte.
Evidence based Medicine (EBM)
Heute wird weltweit zur Eindämmung des entfesselten Machbarkeitsdenkens eine sogenannte "Evidence Based Medicine" (EBM) eingefordert1. Sie beruht auf der Überlegung, daß der Patient nicht allein aufgrund der unabdingbaren individuellen klinischen Erfahrung des Arztes und seines Könnens behandelt werden soll, sondern daß dieses Wissen auch durch die aktuelle wissenschaftliche Evidenz gesichert werden muß. Dabei gilt es, gesicherte Wirksamkeit von hypothetischer kritisch abzugrenzen. Dazu werden heute immer mehr großangelegte kontrollierte Multicenterstudien durchgeführt und mit Hilfe von bestimmten statistischen Techniken zu Meta-Analysen zusammengefaßt.
Die Kehrseite dieser Entwicklung besteht nun darin, daß Ärzte heute mit einer Unmenge von Daten konfrontiert werden, aufgrund derer eine ganz bestimmte Therapie zum Teil mit einer Unbedingtheit gefordert wird, der sich der praktisch tätige Arzt kaum ohne schlechtes Gewissen entziehen kann. In den USA besteht sogar zunehmend die Tendenz, verschiedene Gesellschaften, Organisationen (z.B. MCO - Managed-care) zu gründen oder von Staats wegen auf der Basis von EBM Richtlinien verbindlich festzulegen, wie der Arzt diagnostisch und therapeutisch vorzugehen hat.2 Wenngleich die Evidence Based Medicine (EBM) durchaus positive Seiten hat, so stellt sich hier doch immer deutlicher die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer solchen Entwicklung.
Dazu ein praktisches Beispiel: Würde sich der praktisch tätige Arzt nach den derzeitigen evidenzgesicherten Therapieempfehlungen richten, dann müßte er heute jeden Patienten nach Herzinfarkt automatisch - das heißt, ohne überhaupt nachzudenken - zumindest mit vier bzw. fünf Medikamenten-Gruppen behandeln: Nämlich mit Beta-Rezeptoren-Blockern, ACE-Hemmern, mit den sog. Statinen und mit Aspirin. Dazu kommen noch ein H2-Blocker zur Ulcus-Prophylaxe (wegen Aspirin), bei Frauen Östrogene, Biphosphonate, Fluor-Kalzium-Präparate und Vitamin D zur Osteoporose-Prophylaxe und dazu noch die krankheitsspezifischen Therapie- bzw. Behandlungsempfehlungen aus anderen Fachdisziplinen. Der bloße Hausverstand reicht aus, um zu erkennen, daß eine solche Vorgangsweise für den Patienten eher schädlich, keinesfalls aber nützlich sein kann. Wissenschaftlich gesicherte Daten (EBM) sind zwar ein notwendiger, keinesfalls aber schon ein ausreichender Grund, um eine Therapie im Einzelfall zu beginnen. EBM legitimiert zu einem KANN, verpflichtet aber nicht zu einem MUSS! Immer sollte in einem weiteren Schritt die Frage gestellt werden: Wie sinnvoll ist diese Therapie für diesen konkreten Patienten?
Dazu ist es notwendig, Richtwerte auszuarbeiten, anhand derer der zu erwartende Nutzen einer Behandlung für den einzelnen Patienten meßbar wird, nachdem die prinzipielle Wirkung (Signifikanz) feststeht. Die Gefahr einer Medizin, die ausschließlich auf statistischer Signifikanz basiert (EBM), besteht gerade darin, Patienten nach Mehrheitsverhältnissen im Kollektiv zu behandeln, ohne seine individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Meta-Analysen, Computerprogramme und pauschale Richtlinien von Konsens-Konferenzen sind starre, statische Größen. Sie können zwar dem Arzt eine große Hilfe in Diagnose und Therapie sein, ihm aber niemals eine Therapieentscheidung aufzwingen oder ihm umgekehrt die Verantwortung für seine Entscheidung im Einzelfall abnehmen.
Es geht also darum, die Ergebnisse der EBM sinnvoll für die Entscheidungsfindung am individuellen Patienten nutzbar zu machen!
Verhältnismäßigkeit (V)
Die ärztliche Entscheidung resultiert immer aus einem dynamischen Prozeß vielfältiger Überlegungen. Diese müssen neben der theoretischen Wirkung auch die Zweckmäßigkeit (Wirksamkeit) einer Therapie und ihre Relevanz berücksichtigen und sie ins rechte Verhältnis zu den individuellen Bedürfnissen des Patienten setzen (Prinzip Verhältnismäßigkeit). Erst dann kann beurteilt werden, wie sinnvoll, d.h. hilfreich, eine Behandlung für den konkreten Patienten letztlich wirklich ist. Sinnvoll erscheint eine Therapie-Empfehlung nur dann, wenn sie dem Patienten in seiner Gesamtheit nützt.
Ärztliche Kunst besteht also gerade darin, aus einem Netzwerk vielfältiger objektiver und subjektiver Komponenten im partnerschaftlichen Dialog mit dem individuellen Patienten selbst, die letztlich für ihn richtige und daher sinnvolle Entscheidung zu treffen.
Plakativ gesagt: Die Herausforderung in der heutigen Medizin besteht in der Frage: Wer braucht was? Und nicht in dem Motto: Jeder braucht alles! In den USA ist in dieser Frage seit einiger Zeit schon die sog. "futility"-Diskussion im Gange, ohne daß man aber bisher zu schlüssigen Ergebnissen gekommen wäre.3
Das Konzept einer sinnorientierten Medizin beschäftigt sich eingehend mit dieser Problematik und bietet Ansätze zu einer Lösung. In der Folge werden diese Ansätze, an deren Anwendbarkeit noch sehr viel zu arbeiten ist, vorgestellt.
II. S.O.M. im Detail
1. Stufe 1: Der qualitative Nutzen
Die Analyse des qualitativen Nutzens basiert auf der wichtigen Unterscheidung zwischen Effekt und Wirksamkeit4.
1.1 Effekt
Grundvoraussetzung einer sinnorientierten Medizin sind wissenschaftlich gesicherte Daten über den Effekt einer Therapie. In der EBM (Evidence Based Medicine) werden die statistischen Signifikanzen der verschiedenen Behandlungsstrategien bzw. deren wissenschaftliche Validität auf den verschiedensten Gebieten der Medizin überprüft und zusammengestellt. Dies ist ein wichtiger erster Schritt in einer sinnorientierten Medizin (S.O.M.).
1.2 Wirksamkeit (Zweckdienlichkeit)
Mit einem weiteren Schritt muß überprüft werden, ob ein statistisch abgesicherter Effekt auch zweckdienlich, d.h. wirksam ist.
Als wirksam kann eine Behandlung nur dann bezeichnet werden, wenn sie den prinzipiellen Zweck ärztlichen Handelns erfüllt, d.h. wenn sie die klassischen hippokratischen Kriterien: Lebensverlängerung (LV) oder zumindest Leidenslinderung (= Verbesserung der Lebensqualität - LQ)5 bzw. Heilung (HL) erreicht. (Unter Heilung ist die Wiederherstellung der normalen Lebenserwartung und der vollständigen Beschwerdefreiheit zu verstehen.)
Im Grunde bedeutet dies, daß die Erreichung wenigstens einer dieser drei Vorgaben unabdingbare Voraussetzung für eine sinnvolle Behandlung ist.
Man muß eingestehen, daß dies für eine Reihe von Behandlungsstrategien nicht wirklich nachgewiesen ist. Bei vielen Erkrankungen werden hingegen als unmittelbares Ziel nur sogenannte Surrogatparameter behandelt, ohne daß gesichert ist, daß die Behandlung auch in bezug auf die drei oben definierten Endpunkte (LV und LQ bzw. HL) ihren Zweck erfüllt6.
Ein klassisches Beispiel aus der letzten Zeit ist die Behandlung von Herz-Rhythmus-Störungen mit Antiarrhythmika. Jahrzehntelang hat man sich damit begnügt, die Wirksamkeit der Behandlung anhand von EKG-Kurven zu beurteilen. Erst in den letzten Jahren konnte gezeigt werden, daß durch viele dieser Medikamente zwar die Rhythmusstörungen des Herzens behoben wurden, die LQ jedoch nicht verbessert werden konnte und die Lebenserwartung dieser Patienten sogar verkürzt wurde7.
In einem solchen Fall kann gesagt werden, daß die Behandlung der Herz-Rhythmus-Störungen zwar machbar, aber sinnlos ist, weil der ärztliche Handlungszweck dabei verfehlt wird.
Ein anderes Beispiel ist das sogenannte Ansprechen einer Krebsgeschwulst auf eine Chemotherapie (die sogenannte Remission des Tumors). In vielen Studien konnte z.B. eine erhebliche Verkleinerung eines Tumors durch eine Chemotherapie nachgewiesen werden, ohne daß damit auch eine relevante Lebensverlängerung verbunden war (z.B. beim Bauchspeicheldrüsenkrebs oder beim fortgeschrittenen Magenkrebs8,<link typo3>9). Eine Tumorverkleinerung sagt also nicht viel darüber aus, ob bei einem Patienten das Leben verlängert werden kann oder ob die Lebensqualität verbessert wird. Beides könnte sogar durch die Behandlung verschlechtert werden. Oft wird dieser Sachverhalt jedoch verdrängt. Man registriert eine Teilremission und wertet sie als echten Behandlungserfolg für den Patienten10.
Ähnliche Überlegungen könnte man in bezug auf die Senkung des Cholesterinspiegels bei älteren Leuten oder bei der Osteoporose-Behandlung bei älteren Frauen anstellen.
Auch die Durchführung von aufwendigen Operationen könnte in Frage gestellt werden. Es sei nur daran erinnert, daß jahrzehntelang beim Mammakarzinom eine schwer verstümmelnde Operation an der Brust durchgeführt wurde. Erst in den letzten Jahren konnte gezeigt werden, daß eine solche Operation im Vergleich zu einem nur begrenzten Eingriff keinerlei Vorteil in bezug auf die Lebenserwartung hat, während die Lebensqualität solcher radikaloperierten Frauen erheblich schlechter ist.
Die Zweckdienlichkeit (Wirksamkeit) darf freilich nicht nur eine rechnerische, sondern sie muß praktisch vernünftig sein. Gerade hier läuft die EBM Gefahr, fragliche Signifikanzen zu berechnen, die praktisch keine Bedeutung haben.
Als Beispiel sei hier die PRISM-Plus-Studie11 genannt. Dabei wurde die Wirksamkeit von Tirofiban (GP-IIb/IIIa-Rezeptor-Antagonist) bei Patienten mit instabiler Angina Pectoris untersucht. Aufgrund der Ergebnisse wird die Gabe von Tirofiban in Kombination mit Heparin bei instabiler Angina Pectoris allgemein empfohlen. Analysiert man die Daten der Studie jedoch genauer, so erscheint diese Empfehlung in einem höchst fraglichen Licht: Zunächst mußte die Studie für diejenige Gruppe von Patienten vorzeitig abgebrochen werden, die Tirofiban alleine bekommen hatten, weil unter dem neuen Medikament die Mortalität verglichen zu Heparin exzessiv, d.h. um das Vierfache angestiegen war. Aber auch in der Kombination mit Heparin konnte mit dem Medikament weder im Bezug auf die Mortalität noch auf die Herzinfarktrate eine Wirkung erzielt werden. Erst durch die künstliche Herausrechnung eines kombinierten Endpunktes, nämlich Tod, Myokardinfarkt und refraktäre Ischämie konnte doch noch eine gewisse Signifikanz (p < 0,02) und damit ein positives Ergebnis aus der Studie konstruiert werden. Welche Bedeutung dieses Rechenkunststück freilich für den Patienten haben soll, wenn Mortalität und Herzinfarktrate praktisch unverändert bleiben, ist mehr als fraglich.
Hier zeigt sich deutlich, wie man auch in einer EBM zu stark verzerrten Aussagen kommen kann, wenn nicht Kriterien der S.O.M. zusätzlich angewendet werden.
Dieselben Fragen müssen auch bezüglich der Diagnostik aufgeworfen werden. Erfüllen die heute fast schon automatisch angewendeten, aufwendigen diagnostischen Maßnahmen in vielen Bereichen der Medizin (Coronarangiographie, Computertomographie usw.) die Kriterien der Zweckmäßigkeit wirklich?
So konnte erst kürzlich gezeigt werden, daß in den USA ca. 40% der Patienten nach Herzinfarkt einer diagnostischen Angiographie (Herzkranzgefäßröntgen mit Herzkatheter) unterzogen werden, in Kanada hingegen nur 10%. Die Mortalitätsrate nach Herzinfarkt ist jedoch in beiden Ländern gleich hoch. Daraus wurde geschlossen, daß der Großteil der Koronarangiographien in den USA nicht zweckmäßig ist12.
Es ist also notwendig, die Evidenz der Wirkung auf deren Zweckdienlichkeit zu überprüfen. Diese Anforderung einer sinnorientierten Medizin (S.O.M.) wird von der EBM oft nur unzureichend berücksichtigt (vgl. PRISM-Plus-Studie).
2. Stufe 2: Der quantitative Nutzen - Relevanzanalyse (R)
Die Rückführung des ärztlichen Behandlungsauftrages auf die drei Zielparameter LV und LQ bzw. HL reicht freilich nicht aus, um abschätzen zu können, ob im Einzelfall eine Therapie wirklich sinnvoll ist. Dazu ist es notwendig, die Relevanz zu ermitteln, d.h. die Wirksamkeit auch quantitativ zu bewerten. Diese Relevanzanalyse besteht in der Quantifizierung der Erfolgsaussichten, mit der die einzelnen Zielparameter LV und LQ13 erreicht werden, bzw. in der Qualifizierung der Nebenwirkungen (NW). Für die Erfolgsaussicht einer Maßnahme sind zwei Faktoren maßgeblich: 1) die Ansprechrate NNT14 und 2) das Ausmaß des Erreichbaren (M).
Diese zwei Faktoren sind für die drei Zielparameter LV, LQ u. NW jeweils verschieden; so müssen zunächst deren Teilgrößen (d.h. die Quantität (Q) der Wirksamkeit einer Maßnahme in Bezug auf LV, LQ und NW) errechnet werden, und erst daraus ergibt sich die Gesamtrelevanz der Behandlung.
| QLV | = | NNTLV | x | MLV |
| QLQ | = | NNTLQ | x | MLQ |
| QNW | = | NNTNW | x | MNW |
R = f (QLV, QLQ, QNW)
Höchst relevant wäre z.B. eine Behandlung mit 100% Ansprechrate und optimaler LV und LQ (= Heilung).
Eine klassische Heilbehandlung ist z.B. die Therapie der Streptokokkenpneumonie mit Penicillin.
Ein Beispiel aus der jüngeren Zeit ist die Behandlung des Zwölffingerdarmgeschwürs mit Antibiotika und Protonenpumpenhemmern (Heilungschance 95% - 98%).
In der Folge soll skizzenhaft die Berechnung der Relevanz dargestellt werden. Ein dazu geeigneter Algorithmus muß allerdings noch entwickelt werden. Bevor aber die Teilrelevanzen im einzelnen (2.1 bis 2.3) besprochen werden, soll auf die Quantifizierung der Ansprechrate im nächsten Exkurs eingegangen werden.
Exkurs: Quantifizierung der Ansprechrate NNT (Absolutes und relatives Risiko)
Ein wichtiges Kriterium bei der Abschätzung der Relevanz ist die Ansprechrate (A). Ansprechraten werden in der Medizin oft als Risikokennzahlen angegeben. Hier muß vor allem das absolute vom relativen Risiko unterschieden werden. Diese Tatsache wird jedoch in vielen Therapieempfehlungen nicht berücksichtigt. Man begnügt sich mit der Angabe über den relativen therapeutischen Gewinn (kurz relative Risikoreduktion). Es ist jedoch für eine Therapieempfehlung sehr wohl entscheidend zu wissen, wie hoch das absolute Erkrankungsrisiko oder auch das absolute Mortalitätsrisiko tatsächlich ist. Die Reduktion eines absoluten Mortalitätsrisikos von 80% auf 40% ist wohl anders zu bewerten als eine Reduktion von 1% auf 0,5%, auch wenn in beiden Fällen die relative Risikoreduktion gleichermaßen 50% beträgt. Dieser Tatsache wird allerdings in vielen Fällen nicht Rechnung getragen.
Zur Veranschaulichung sei die Therapieempfehlung bei Herzinfarktpatienten mit cholesterinsenkenden Medikamenten aufgrund der sogenannten CARE-Studie15 genannt.
Die Behandlung wird auch von Vertretern der Evidence Based Medicine (EBM) empfohlen16. Begründet wird dies damit, daß koronare Ereignisse signifikant gesenkt werden konnten. Das Risiko eines tödlichen Herzinfarkts konnte sogar um 37% gesenkt werden, heißt es. Das klingt sicher sehr gut, und in der Tat wird kein Arzt zunächst einmal einem Patienten einen derartigen Vorteil vorenthalten wollen. Analysiert man die Daten jedoch genauer, so zeigt sich, daß das absolute Risiko, innerhalb von 5 Jahren an einem Herzinfarkt zu sterben, bei den untersuchten Patienten lediglich 1,8% betrug. Durch die Behandlung konnte diese Sterberate auf 1,2%, also absolut um 0,6% (= 37% von 1,8) gesenkt werden. Dies bedeutet eine Reduktion um 0,12% pro Jahr, also ca. 1 Promille. Von den 37% bleibt also praktisch nichts übrig. Jedenfalls sind die Ergebnisse der vorliegenden Studie, trotz der spektakulären Aufmachung, wegen zu geringer Relevanz (marginale Lebensverlängerung - s.später) bei nur mäßigem Krankheitsrisiko als kaum relevant einzustufen. Hier zeigt sich, daß die Senkung eines relativen Risikos über die therapeutische Relevanz einer Behandlung nichts aussagt (Abb. 1).
Wie wichtig die Berücksichtigung des absoluten Risikos ist, kann vielleicht anhand der Impfung gezeigt werden. Die Relevanz ist in den meisten Fällen hervorragend. Das absolute Risiko aber z.B. in Europa (über Verkehrswege) Gelbfieber zu bekommen, ist so gering, daß eine Impfung zwar möglich, aber als verzichtbar erscheint. Relevant wird sie nur, wenn jemand in ein Land reist, in dem das absolute Erkrankungsrisiko entsprechend hoch ist.
Die Information über das absolute Risiko ist auch deshalb von erheblicher Bedeutung, weil bei geringer Reduktion des absoluten Risikos ein großer Teil der Patienten umsonst behandelt werden muß. Dadurch gewinnt die Frage nach den Nebenwirkungen zunehmend an Gewicht, weil ein Großteil der Patienten diese in Kauf nehmen muß, ohne von der Behandlung tatsächlich zu profitieren17.
Das Verhältnis von umsonst behandelten Patienten und Profit wird heute in der sog. number needed to treat (NNT) gut erfaßt (Anzahl der Patienten, die ein Jahr behandelt werden müssen, um einen Patienten zu "retten"). Sie ist ein guter Parameter für die Ansprechrate.
Bei einer absoluten Reduktion der Herzinfarktmortalität um 1 ‰ pro Jahr in der CARE-Studie sind dies z.B. 999 von 1000 Patienten, die sog. number needed to treat (NNT) beträgt 1000 : 1.
Als weiteres Beispiel sei die Hypertoniebehandlung18 angeführt. Bei einem diastolischen Blutdruck von 105 mm Hg beträgt das absolute Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen, 1,5% pro Jahr. Die NNT, um einen Schlaganfall zu verhindern, beträgt 333 : 1.
Bei einem diastolischen Blutdruck von 95 mm Hg beträgt die NNT 2000:1. Dabei kann der Schlaganfall nicht gänzlich verhindert, sondern nur einige Monate hinausgezögert werden (siehe später).
Zum Vergleich: bei einem jugendlichen Diabetiker ist das Mortalitätsrisiko 100%. Die Ansprechrate auf Insulin ebenfalls 100%, d.h. NNT 1:1 mit Aussicht auf eine fast normale Lebenserwartung!
Auf jeden Fall müßte bei jeder Behandlungsempfehlung neben dem relativen auch das absolute Risiko angegeben werden, damit deren Relevanz abgeschätzt werden kann. Keinesfalls können niedrige Erfolgsraten (z.B. 5 von 1000 - ISIS 4-Studie) dadurch gerechtfertigt werden, daß sie auf die Weltbevölkerung hochgerechnet werden, wie dies häufig geschieht19. Diese Überlegungen können höchstens zur Berechnung des wirtschaftlichen Nutzens für die Herstellung eines Präparates dienen. Für den einzelnen sind sie völlig irrelevant. Für ihn hängt die Sinnhaftigkeit einer Behandlung nicht davon ab, ob es weltweit noch viele oder nur wenige gleichartige Fälle gibt.
Die NNT reicht allerdings nicht aus, um die Relevanz einer Therapie zu quantifizieren, denn sie enthält keine Information über das Ausmaß der Lebensverlängerung.
2.1 Quantifizierung der Lebensverlängerung (QLV)
2.1.1 Das Ausmaß der LV (MLV)
Eine sogenannte signifikante Lebensverlängerung kann z.B. nur wenige Tage umfassen oder bis zu einer normalen Lebenserwartung (= Lebenserhaltung) reichen. Eine Heilbehandlung hätte praktisch immer eine normale, d.h. maximale Lebenserwartung zur Folge.
Gerade bei den heute so modern gewordenen Multicenter-Studien werden aber oft an zehntausenden von Patienten sog. Signifikanzen von Behandlungserfolgen errechnet, deren Wirksamkeit mehr als fraglich ist.
Als Beispiel sei die Behandlung von Herzinfarktpatienten mit sogenannten ACE-Hemmern angeführt20 (ISIS 4 Studie). Die Untersuchungen wurden an 58.050 (!) Herzinfarktpatienten durchgeführt. In der Publikation heißt es, daß bei einer frühzeitigen Gabe von ACE-Hemmern nach Myocardinfarkt 5,4 von 1000 Leben "gerettet" werden können (NNT = 200:1). Diese Aussage könnte nur dann stimmen, wenn tatsächlich die 5 "geretteten" Patienten nach dem Herzinfarkt eine normale Lebenserwartung hätten, also gesund werden. Welcher Arzt will nicht 5 Leben retten, wenn der Patient danach wirklich geheilt nach Hause gehen kann? Er könnte sich daher keinesfalls der Verschreibung von ACE-Hemmern entziehen! Die Behandlung wäre trotz der niedrigen Ansprechrate sehr effektiv. In Wirklichkeit kann bei einem Herzinfarkt-Patienten bekanntlich von Heilung gar keine Rede sein, sondern durch ACE-Hemmer kann bestenfalls das "Remodeling" des Restmyocards vermindert werden. Dadurch steigt die Überlebensrate von 89,47% auf 90,13% = 0,66% nach 6 Monaten bzw. von 87,47% auf 88,01% im ersten Jahr.
Analysiert man diese Daten genau, so bedeutet dies, daß in der Behandlungsgruppe bereits 56 Tage später ebenso viele Patienten tot sind wie in der nichtbehandelten Gruppe. Es kommt also nur zu einer geringfügigen Verschiebung des Todeszeitpunktes (vgl. Abb. 2).
Approximative Rechnung: Nach einem halben Jahr konnte eine Reduktion der Mortalität um 0,66% erreicht werden (90,13 - 89,47 = 0,66). Die Mortalität innerhalb der zweiten Hälfte des Jahres betrug in der Behandlungsgruppe 2,12% (90,13 - 88,01 = 2,12). Daraus läßt sich errechnen, wieviele Tage später als in der Plazebogruppe auch in der Gruppe der Behandelten nur mehr 89,47% der Patienten leben bzw. um wieviele Tage später die "geretteten" 0,66% Patienten ebenfalls gestorben sind.
| Rechnung: | 182 x 0,66 | = 56 Tage (vgl. Abb. 2) |
| 2,12 |
Es müßte in der Publikation also in Wahrheit heißen: Durch die Verabreichung von ACE-Hemmern profitieren 5 von 1000 behandelten Patienten im ersten Jahr. Dieser Profit besteht in einer Lebensverlängerung von nur wenigen (ca. 56) Tagen.
Mehr kann aus den Daten dieser Studie nicht herausgelesen werden!
Unter der fiktiven Annahme, daß die Wirkung auch nach dem ersten Jahr weiter anhält (die Kurven müßten dann in der Folge allerdings auseinanderlaufen - was tendenziell nicht abzulesen ist), ergäbe sich bei einer Mortalitätsrate von jährlich 5% eine Verlängerung der medianen Überlebenszeit (ÜLZ) von 10 auf 11 Jahre (also keine "Heilung")! Zum Vergleich: Die Mortalitätsjahresrate in einem altersadjustierten Normalkollektiv (60 Jahre) beträgt 1% jährlich, die Lebenserwartung 20 Jahre.
Approximative Rechnung: Mortalitätsrate von 5% (Überlebensrate 95%) ergibt eine mediane (50% Überlebende) ÜLZ von ca. 10 Jahren (5% x 10 = 50%).
Mortalitätsrate 4,5% (minus 0,5%) ergibt eine mediane ÜLZ von 11,1 Jahren (4,5% x 11,1 = 50%).
Bei einem weiteren parallelen Verlauf der Kurven wie bisher würde die Lebensverlängerung auch nach 10 Jahren nur 56 Tage betragen (für 5 von 1000 Patienten bzw. 1 von 200).
Wenn man z.B. bedenkt, daß durch ein regelmäßiges Gehtraining die Lebenserwartung bei 69-jährigen Männern von 5 auf 12 Jahre verlängert werden kann21, so ist die Relevanz einer ACE-Hemmer-Therapie wohl nur sehr niedrig zu beziffern.
Die Insulintherapie bei einem jugendlichen Diabetiker z.B. ist höchst effektiv. Während der Patient ohne Insulin innerhalb weniger Tage stirbt, hat er bei einer fachgerechten Insulinbehandlung eine fast normale Lebenserwartung.
Unter diesen Auspicien wird wohl der Nutzen (Relevanz) eines ACE-Hemmers ganz anders zu bewerten sein, als wenn ständig mit dem Wort Lebensrettung operiert und damit vollständige Heilung suggeriert wird.
2.1.3 Der Quantifizierungsparameter NNTa bzw. LVi für QLV
Um die LV quantitativ beurteilen zu können, müssen also sowohl Ansprechrate (NNT) als auch Ausmaß der LV (MLV) gemeinsam beurteilt werden.
Man könnte daher die NNT (= Ansprechrate) und die LV zu einem einzigen Parameter zusammenfassen, z.B. als number of years needed to treat in order to gain an additional year (NNTa). Es wäre dies die Anzahl von Patientenjahren, die behandelt werden muß, um ein weiteres Lebensjahr dazu zu gewinnen. Die NNTa sind für die erwähnten Beispiele aus Tabelle V ersichtlich. Je niedriger der Wert, desto höher ist die Wirksamkeit einer Therapie.
| Formel: NNTa = | NNT | (Jahre) |
| LV |
Man könnte aber aus NNT und LV bzw. NNTa auch umgekehrt die Lebensverlängerung (LVa) berechnen, die rechnerisch jedem Patienten nach einem Behandlungsjahr zukommen würde:
| LVa = | LV |
| NNT |
| Es ist dies der reziproke Wert von NNTa ( | 1 | ). |
| NNTa |
Daraus ließe sich dann die zu erwartende fiktive Lebensverlängerung des jeweils individuellen Patienten (LVi) berechnen, indem man LVa mit der zu erwartenden Behandlungsdauer (durchschnittliche Lebenserwartung - LE) des jeweils konkreten Patienten multipliziert.
Beispiel CARE-Studie (vgl. auch Tabelle V):
NNT = 500 : 1
LV = 8 Monate = 0,66 a (für einen von 500 Patienten)
NNTa = 500 = 750 a 0,66
d.h. durch 750 Behandlungsjahre (Patientenjahre) kann ein Jahr dazu gewonnen werden.
LVa = 1 (Jahre) = 365 Tage = 0,48 Tage bzw. ca. 12 Stunden 750 750
d.h. durch 1 Behandlungsjahr können 12 Stunden dazugewonnen werden.
Bei einer Lebenserwartung (LE) von z.B. 10 Jahren (= 10 Behandlungsjahre) können daher 4,8 Tage dazugewonnen werden (LVi = 4,8 Tage)
Darüber hinaus hat die Berücksichtigung der NNTa auch einen erheblichen ökonomischen Aspekt (siehe 3.2).
2.2 Quantifizierung der Lebensqualität (QLQ)
Auch über die Verbesserung der LQ könnte ein Scoring vorgenommen werden, z.B. Graduierung der Schmerzlinderung bis zur Schmerzfreiheit. Dazu gibt es reichlich Literatur. Das Ausmaß der LQ muß dann ähnlich wie bei der Lebensverlängerung (QLV) mit der Ansprechrate NNT zu einem Relevanzparameter (QLQ) kombiniert werden.
2.3 Quantifizierung der Nebenwirkungen (QNW)
Die Qualifizierung von LV und LQ sind wie gesagt wichtig, weil sie gegen die Nebenwirkungen abgewogen werden müssen. Erst daraus ergibt sich die Relevanz, d.h. der wirkliche Nutzen einer Therapie.
Während eine so effektive Therapie wie die Insulinbehandlung außer Diskussion steht, gewinnt bei niedrigem absoluten Risiko und nur geringfügiger Lebensverlängerung (hohe NNTa) das Prinzip primum nil nocere zunehmend an Gewicht. Die Wahrscheinlichkeit, mehr zu schaden als zu nützen, wird immer größer. Die Dringlichkeit der Behandlung wird immer geringer. Wenn daher bei einer kaum effektiven Therapie wie in den obigen Beispielen Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten durch die Behandlung auftreten, so wird wohl kein relevanter Fehler gemacht, wenn auf die Weiterbehandlung verzichtet wird.
Im Fall der ACE-Hemmer könnten die Nebenwirkungen des Medikaments das Allgemeinbefinden des Patienten erheblich beeinträchtigen. (Nebenwirkungen unter ACE-Hemmern treten in ca. 17% auf.) Die Wahrscheinlichkeit, von der Therapie zu profitieren, beträgt hingegen in der CARE-Studie nur 0,5%. Wenn es tatsächlich um Leben oder Tod ginge, müßte man dem Patienten diese Beeinträchtigung zumuten. Bei einer Therapie mit praktisch unbedeutender Lebensverlängerung und nur marginaler Risikoreduktion kann hingegen das Medikament ruhig abgesetzt werden, wenn Nebenwirkungen auftreten, ohne daß dabei ein relevantes Risiko eingegangen wird.
Noch gravierender ist die Frage nach der Relevanz bei Therapieempfehlungen, die von vornherein eine große Belastung für den Patienten durch Nebenwirkungen darstellen, insbesondere wenn die Nebenwirkungsraten höher liegen als die Wahrscheinlichkeit der Wirkung, wie z.B. bei der onkologischen Chemotherapie oder der Mehrfachkombination mit hochpotenten antiviralen Substanzen bei HIV-Infektion. In diesen Fällen kann 100%ig mit Nebenwirkungen gerechnet werden, während Ansprechraten und das Ausmaß der Lebensverlängerung nur sehr gering sind. Hier wird also um den hohen Preis von erheblichen Belastungen für den Patienten ein nur sehr bescheidener Erfolg erzielt.
Als Beispiel sei die adjuvante Chemotherapie bei im Durchschnitt 50-jährigen Patientinnen nach einer Brustkrebsoperation angeführt. Dies ist eine etablierte vorbeugende Therapie, von der eine definitive Heilungschance behauptet wird22. Dabei beruft man sich auf eine Studie von Bonadonna23, bei der Patientinnen über 20 Jahre beobachtet werden konnten. Quantifiziert man den Nutzen dieser Therapie, so zeigt sich, daß auch hier von Heilungschancen kaum die Rede sein kann. Die mittlere Lebenserwartung konnte durch die Chemotherapie von 8,6 auf 11,4 Jahre verlängert werden. (Die Lebenserwartung von 50-jährigen Frauen in der Gesamtbevölkerung beträgt hingegen weitere 30 Jahre - vgl. Tabelle II). Der Anteil der Überlebenden nach 15 Jahren war um 6% höher als in der Kontrollgruppe. Dies bedeutet, daß 94% aller Patientinnen umsonst behandelt werden, damit eine profitiert (NNT= 17/1). Anders gesagt: 94% der behandelten Patientinnen müssen erhebliche Nebenwirkungen in Kauf nehmen, ohne davon auch nur im geringsten zu profitieren. Sollte bei den restlichen 6% der Patientinnen durch die Chemotherapie wirklich eine echte Heilung erfolgen, dann müßte sich dies zumindest in den Spätdaten der Überlebenden nach 20 Jahren niederschlagen. Es wäre zu erwarten, daß sich die Mortalität wenigstens in den letzten 5 Jahren, (also wenn die Patientinnen bereits 65 Jahre alt sind) der Durchschnittsbevölkerung annähert. Dies ist aber absolut nicht der Fall. Im Gegenteil: die Rückfallsrate in den letzten 5 Jahren war in der Behandlungsgruppe größer (9%) als in der Kontrollgruppe (3%). Die Incidenz für Mammacarzinom in der Gesamtbevölkerung dieser Altersgruppe beträgt hingegen nur 0,1% (bzw. 0,5% in 5 Jahren)24. Die Mortalität in beiden Gruppen war mit 21 bzw. 22% ebenfalls deutlich höher als in der Durchschnittsbevölkerung (5%).
| 50a | Lebenserwartung | Überlebende nach 15 Jahren | Rückfallquote | 5jährige Mortalität |
|---|---|---|---|---|
| zwischen 15. und 20. Jahr nach Behandlung | ||||
| Kontrolle | 8,6a | 23% | 3% | 22% |
| Adjuvante Chemotherapie | 11,4a |
29% (+6%) NNT: (17/1) |
9% | 21% |
| Durchschnittsbevölkerung | 30a | 92% | 0,5% (Inzidenz) | 5% |
Diese Tatsache ist doch von erheblicher praktischer Bedeutung. Es ist nämlich sehr wohl ein Unterschied, ob man einer Patientin durch eine Chemotherapie eine echte Heilungschance mit einer Lebenserwartung von weiteren 30 Jahren oder eben "nur" einen Überlebensvorteil von 8,6 auf 11,4 Jahre (= + 3 Jahre) anbieten kann (was man bestenfalls als mäßig wirksam bezeichnen kann). Dies ist besonders dann relevant, wenn eine Patientin, aus welchen Gründen auch immer (psychisch oder physisch), zu einer (weiteren) Chemotherapie negativ eingestellt ist. Immerhin führt z.B. eine (adjuvante) Chemotherapie bei jüngeren Frauen um 40a abgesehen von den üblichen Nebenwirkungen (Haarausfall, Abgeschlagenheit, BB-Schäden usw.) zur vorzeitigen Menopause mit den daraus resultierenden Beschwerden und Risiken (z.B. Osteoporose) und außerdem zur Unfruchtbarkeit. In einem solchen Fall müßte der mündigen Patientin der quantitative Nutzen ehrlich vorgelegt werden, um ihr eine echte und freie Wahl für oder gegen eine (weitere) Therapie zu ermöglichen. Sicherlich werden für viele Patientinnen drei möglicherweise (6% Wahrscheinlichkeit) gewonnene Jahre (z.B. für eine Mutter, die vielleicht noch unversorgte Kinder hat) sehr wichtig sein, und die meisten werden Nebenwirkungen und Risiken trotz der geringen Relevanz in Kauf nehmen. Andererseits darf man aber auch nicht übersehen, daß z.B. der quantitative Nutzen von Gewichtabnahme, das Einstellen von Rauchen oder körperliche Bewegung in bezug auf gewonnene Lebensjahre wesentlich effizienter ist, ohne daß die Betroffenen daraus immer Konsequenzen ziehen, und zwar dann nicht, wenn sie die damit verbundenen Unanehmlichkeiten nicht in Kauf nehmen wollen.
Aus den Beispielen geht deutlich hervor, daß Signifikanzen, die in Multi- und Metastudien errechnet und mit Hilfe der EBM evaluiert werden, nicht ausreichen, um daraus eine generelle Therapieempfehlung abzuleiten. Therapiekonzepte bzw. diagnostische Maßnahmen müssen mehr Vorteile als Nachteile bringen. Mit anderen Worten: Sie müssen mehr nützen als schaden. Die Nebenwirkungen können jedenfalls den Nutzen einer Therapie stark beeinträchtigen.
Ein anderes Beispiel ist die Behandlung des Schlaganfalls mit Medikamenten, die das entstandene Blutgerinnsel im Gehirn auflösen sollen (Streptokinase). Bei dieser Therapie kommt es zu keiner Heilung, zu keiner Lebensverlängerung, aber zu einer etwas (nicht signifikant) besseren LQ nach Schlaganfall. Allerdings wäre dabei eine erhöhte Mortalitätsrate durch Hirnblutungen in Kauf zu nehmen25. Hier steht wohl das Nebenwirkungsrisiko (Tod) in einem höchst fragwürdigen Verhältnis zum Nutzen (bessere Lebensqualität) einer solchen Therapie. Die Behandlung hat zwar eine gewisse Wirksamkeit, ist aber für die Praxis nicht wirklich relevant, d.h. für den Patienten unbedeutend.
Ein weiteres Beispiel ist die hochdosierte sogenannte adjuvante Chemotherapie (inklusive Knochenmarkstransplantation) bei Patientinnen mit Brustkrebs, deren Prognose sehr schlecht ist. Es handelt sich hier um ein äußerst belastendes Verfahren mit hohem Mortalitätsrisiko26 für die Patientinnen. Diese Behandlung strebt an sich Heilung an, die Erfolgsaussichten sind allerdings minimal, wenn überhaupt gegeben (wenig wirksam: 1 Punkt).
In Anbetracht des hohen Mortalitätsrisikos, der erheblichen Nebenwirkungen und des äußerst ungewissen Ausgangs ist der Wert dieser Behandlung sehr fraglich und für die Patientin nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft durchaus verzichtbar (nicht relevant).
Die Quantifizierung der Nebenwirkungen (QNW) wäre ebenfalls Aufgabe dieses Projekts. Sie könnte als negativer Korrekturfaktor zur Lebensqualität aufgetragen werden (vgl. Tabelle III), z.B. in Korrelation zur NNT als NNH (number needed to harm) in Kombination mit dem Schweregrad (MNW) der NW.
Die Nebenwirkungsrate bei Antihypertensiva beträgt z.B. ca. 20%. NNH wäre demnach 5:1. Bei der Behandlung der milden Hypertonie (NNT 2000:1) würde dies bedeuten, daß von 2000 Patienten, die umsonst behandelt werden, 400 darüber hinaus auch Nebenwirkungen ertragen müßten, damit ein einziger Patient profitiert (d.h. dieser eine Patient würde den Schlaganfall einige Monate später bekommen als ohneTherapie).
2.4 Ermittlung von Relevanz-Skalen
Man könnte die Teilgrößen für QLV, QLQ und QNW zur Vereinfachung in ein Skalensystem umrechnen und folgendermaßen klassifizieren:
1 = wenig wirksam
2 = mäßig wirksam
3 = wirksam
4 = sehr wirksam
5 = höchst wirksam
Aus den 3 Teilgrößen für QLV, QLQ und QNW ergibt sich eine Tabelle, anhand deren dann die gesamte Relevanz einer Behandlung ermittelt werden kann.
Tabelle III zeigt das Grundprinzip exemplarisch, die Zahlen sind völlig willkürlich:
| QLV | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| QNW | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| QLQ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Daraus ergibt sich eine Skala von 9 bis -3, die folgendermaßen unterteilt werden könnte (Tabelle IV):
| Summe | Relevanz |
|
> 8 Punkte 7 - 5 Punkte 4 - 2 Punkte 1 - 0 Punkte neg. Wert |
sehr relevant relevant (wichtig) mäßig relevant (entbehrlich) kaum relevant (verzichtbar) nicht relevant |
I Sehr relevant für einen Patienten wäre eine Behandlung, deren QLV sehr hoch ist (5 Punkte), die kaum Nebenwirkungen hat (minus 1 Punkt), und bei der auch QLQ hoch ist (5 Punkte), z.B. Schrittmacher.
(Summe: 9 Punkte)
II Relevant wäre eine höchst wirksame LV (5 Punkte) mit nur geringen Nebenwirkungen (minus 2 Punkte) und mit wirksamer Verbesserung der LQ (3 Punkte), z.B. Insulintherapie. (Summe: 6 Punkte) Relevant wäre aber auch eine rein palliative Therapie (QLV = 0) mit erheblicher Verbesserung der LQ.
(Summe: 5 Punkte)
III Mäßig relevant wäre eine wirksame LV (3 Punkte) mit mäßigen Nebenwirkungen (minus 2 Punkte) und geringer QLQ (1 Punkt), z.B. adjuvante Chemotherapie.
(Summe: 2 Punkte)
IV Kaum relevant (verzichtbar) ist eine Behandlung mit wenig Wirkung auf QLV (1 Punkt), wenig Nebenwirkungen (minus 1 Punkt) und keiner QLQ (0 Punkte), vgl. CARE-Studie, ISIS-4-Studie.
(Summe: 0 Punkte)
V Nicht relevant wäre eine Therapie, bei der der Schaden größer ist als der Nutzen, z.B. hochdosierte adjuvante Chemotherapie bei Brustkrebs.
(Summe: negativer Wert)
Die Bestimmung der Relevanz hat also den Sinn, die Aussagekraft der verfügbaren Daten für den praktisch tätigen Arzt durchschaubar zu machen. Erst dadurch kann er den tatsächlichen Nutzen einer Therapie richtig einschätzen und eine Therapieentscheidung treffen, die für den einzelnen Patienten maßgeschneidert ist. Bei kaum relevanten Behandlungen wird man sich leicht tun, das primäre Ziel einer LV aufzugeben (z.B. wegen Nebenwirkungen), um sich ganz auf die palliative Verbesserung der LQ zu verlegen. Auf diese Weise müßten alle heute verfügbaren Studien untersucht werden, um sie für die Entscheidungsfindung des Arztes beim konkreten Patienten transparent zu machen.
3. Stufe 3: Der praktische Nutzen - Verhältnismäßigkeitsanalyse
Der letzte und definitive Schritt ist die Entscheidung, ob und welche medizinische Maßnahme bei einem konkreten Patienten sinnvollerweise angewendet werden soll. Sinnvoll ist, was für den konkreten realen Menschen in seiner Ganzheit (nicht nur medizinisch-biologisch) und unter Berücksichtigung aller persönlichen Umstände hilfreich und, darüber hinaus, angemessen ist. Wir haben gesehen, daß die Ergebnisse der Evidence-Based-Medicine (EBM) nicht das einzige Richtmaß sein können, sondern daß Zweckdienlichkeit und auch die Relevanzfaktoren weitere Kriterien einer sinnorientierten Medizin sind. Diese sind allgemeine objektive Entscheidungsrichtlinien, die aber noch auf den konkreten Fall, d.h. den konkreten Patienten angewandt werden müssen. Es geht nun in der 3. Stufe um den Sprung von der allgemein geltenden, theoretischen und normativen Ebene auf die Ebene der Praxis, d.h. der konkreten sinnvollen Handlung. Dieser Sprung erfordert nicht nur die Berücksichtigung von Normen und Richtlinien, sondern auch der persönlichen Umstände des konkreten Menschen, der immer mehr ist als nur eine statistische Größe! Das praktische Kriterium, das letztlich die Gesamtheit der zu berücksichtigenden Faktoren einbezieht und die Brücke zwischen der allgemeinen normativen und der konkreten partikulären Ebene schlägt, ist die Verhältnismäßigkeit, die ein Aspekt der Klugheit ist. Sinnvoll wird demnach das Verhältnismäßige und sinnlos das Unverhältnismäßige sein. Dabei spielen auch ökonomische Faktoren mit eine Rolle.
Das Kriterium der Verhältnismäßigkeit als Aspekt der Klugheit ist ethischer Natur. Gerade weil die ethische eine alle anderen Kompetenzen (ökonomische, medizinische, wissenschaftliche, lebensweltliche usw.) integrierende Kompetenz ist, wird sie hier besonders gebraucht. Es ist klar, daß das Kriterium, das die Qualifizierung einer Handlung als sinnvoll erlaubt, ethische Dimensionen wie Würde der Person, Selbstbestimmungsrecht, Gemeinwohl, Verteilungsgerechtigkeit, Individualität usw. berücksichtigen muß.
Zur Beurteilung der Verhältnismäßigkeit gilt es, neben den oben erwähnten normativen Kriterien EBM, Zweckdienlichkeit und Relevanz, ökonomische sowie individuelle Faktoren gegeneinander abzuwägen.
3.1. Individuelle Faktoren der Verhältnismäßigkeit
Damit sind jene Merkmale gemeint, die den konkreten Fall charakterisieren. Die sinnvolle Maßnahme kann nicht von diesen Faktoren absehen.
Die individuellen Faktoren kann man in objektive und subjektive unterteilen: Objektive individuelle Faktoren der Verhältnismäßigkeit (O) sind zum Beispiel: Alter, Bewußtseinslage, Lebenserwartung27, menschliches (soziales) Umfeld und sonstige persönliche Daten. Sie sind insofern objektiv, als sie, unabhängig vom Willen des Subjektes, auch für dritte feststehen. Subjektive (S) Faktoren der Verhältnismäßigkeit sind Wertvorstellungen, subjektive Präferenzen und Interessen sowie Zielvorstellungen.
Für einen Patienten, der noch eine in seinen Augen ganz wichtige Aufgabe zu erledigen hat, wird vielleicht eine kurze Zeit der Lebensverlängerung, in der er dies noch erreicht, von erheblicher Bedeutung sein. Andererseits sind Lebensverlängerung als solche und die Gesundheit überhaupt nicht immer und unter allen Umständen der höchste Wert. In gewisser Hinsicht setzen wir unser Leben bzw. die Gesundheit um einer bestimmten Sinnerfüllung willen ständig aufs Spiel. Man denke z.B. an eine Mutter, die ihre Kinder zur Welt bringt, aber auch z.B. an riskante Hobbys wie Drachenfliegen, Bergsteigen oder Tauchen, an Rauchen oder an das Autofahren, auf das niemand verzichten will usw.
Letztlich ist eine Therapie nur dann sinnvoll, wenn sie dem Patienten in seiner Gesamtheit nützt, wenn also das Machbare ins Verhältnis zum praktisch Vernünftigen gesetzt wird. Wenngleich bei dieser Entscheidung letztlich der mündige Patient immer das endgültige Wort hat, so besteht die Kunst des Arztes gerade darin, dem Patienten nach der Abwägung einer Vielzahl von unterschiedlichen und z.T. divergierenden Komponenten (vgl. z.B. Nebenwirkungen) einen auf ihn zugeschnittenen, vernünftigen Rat zu erteilen. Hier wird vom Arzt ein hohes Maß an Klugheit gefordert, die als Kardinaltugend auch der ärztlichen Kunst bezeichnet werden kann. In den meisten Fällen kann der Patient nämlich nicht wirklich abschätzen, was auf ihn zukommt, wenn ihm eine bestimmte Therapie vorgeschlagen bzw. angeraten wird. Es kommt also sehr auf die Dringlichkeit an, mit der eine Therapieempfehlung ausgesprochen wird, ob sich der Patient dann dafür oder dagegen entscheidet.
3.2 Der ökonomische Faktor: die Effizienz
Die Kriterien der S.O.M. haben aber auch einen erheblichen ökonomischen Aspekt.
Das subjektive Wohl des einzelnen Patienten kann bekanntlich nicht ohne Rücksicht auf das Gemeinwohl verwirklicht werden. Letztlich wird man daher auch noch einen objektiven Korrekturfaktor brauchen, insbesondere dann, wenn von der Allgemeinheit bzw. Gesellschaft erhebliche Ressourcen bzw. Opfer eingefordert werden.
Die Ressourcenknappheit zwingt die immer aufwendigere Medizin zu einer gerechten Verteilung der nicht unbegrenzten Mittel.
Die heutigen Methoden der Kosten-Nutzenanalysen sind stark von den fiktiven Annahmen abhängig, auf denen sie basieren. Grundsätzlich kann aber gesagt werden, daß eine Therapie mit Kosten/Nutzen-Neutralität von einem ökonomischen Standpunkt aus wesentlich leichter vertretbar ist als eine kostspielige Behandlung28.
Eine Kosten/Nutzen-Neutralität im Gesundheitswesen nach den Prinzipien der freien Marktwirtschaft ist allerdings in den meisten Fällen nicht erreichbar. Als alleinige Entscheidungsgrundlage bei der Verteilung von Ressourcen wäre sie unbrauchbar. Wenn nämlich nur "rentable" Behandlungen von der Allgemeinheit bezahlt würden, während "unrentable" den Wohlhabenden vorbehalten blieben, weil nur sie es sich leisten können, dann wäre dies unsozial und inhuman.
Einschränkungen können daher nicht einfach nach dem Prinzip teuer oder billig gemacht werden, sondern es kommt darauf an, das Notwendige und Sinnvolle zu tun, das Überflüssige jedoch zu unterlassen. So kann ein chancengleiches Angebot auf hohem medizinischem Niveau gewährleistet werden (Qualitätssicherung), ohne wertvolle Ressourcen zu vergeuden. S.O.M. kann dazu einen wesentlichen Beitrag leisten.
Als Beispiel sei nochmals die Cholesterinsenkung mit Pravastatin angeführt:
In der sogenannten CARE-Studie konnte eine Senkung der Mortalität von 9,4 auf 8,3% (= Reduktion um 1% absolut bzw. 10% relativ) innerhalb von 5 Jahren erzielt werden (nicht signifikant). Die generelle Gabe von Pravastatin an alle Patienten mit coronarer Herzkrankheit (unabhängig vom Cholesterinspiegel) wird bereits gefordert.
Beurteilt man die Studie nach den Kriterien der Sinnorientierten Medizin (S.O.M.) so ergibt sich:
Eine Cholesterinsenkung führt nicht zur Heilung eines Herzinfarktpatienten. Es kann daher nur zu einer Verschiebung des Todeszeitpunktes (LV) kommen. Diese beträgt letztlich 7,7 Monate.
Approximative Rechnung: In 5 Jahren (60 Monaten) starben von 100 Patienten in der Behandlungsgruppe nicht 9,4% (wie in der Kontrollgruppe), sondern nur 8,3%, d.h. 1 Patient weniger. Da nicht alle Patienten auf einmal plötzlich starben, sondern kontinuierlich auf 5 Jahre verteilt, ist in der Kontrollgruppe ca. alle 6,3 Monate ein Patient verstorben (60 : 9,4 = 6,3 Monate). 8,3% der Patienten in der Kontrollgruppe waren bereits nach 52,3 Monaten tot (6,3 x 8,3= 52,3), in der Behandlungsgruppe erst nach 60 Monaten. Daraus ergibt sich eine Differenz von 7,7 Monaten. D.h. nach 7,7 Monaten waren in der Behandlungsgruppe ebenso viele Patienten tot wie in der Kontrollgruppe. Berücksichtigt man, daß in nur 5 Jahren 1% der Patienten von dieser Behandlung profitiert hat (und zwar 7,7 Monate Lebensverlängerung), so erscheint die Therapie kaum relevant. Man wird auf diese Therapie aufgrund der Kriterien der S.O.M. zumindest bei Patienten mit normalem Cholesterinspiegel leichter verzichten können (insbesondere wenn Nebenwirkungen auftreten), als wenn allein von evidenzgesicherter Lebensrettung gesprochen wird.
Berechnet man die Kosten, so ergibt sich, daß pro behandeltem Patienten in 5 Jahren öS 73.000.- anfallen. (Rechnung: 40 mg Pravastatin pro Tag = öS 40.- pro die = 73.000.- in 5 Jahren).
Eine Senkung der Mortalität um 1% heißt, daß 100 Patienten behandelt werden müssen, damit 1 Patient profitiert (99% werden hingegen umsonst behandelt). Damit kostet dieser 1 Patient der Gesellschaft innerhalb von 5 Jahren öS 7,3 MIO (100 Patienten x öS 73.000.- = öS 7,3 MIO).
Da der Todeszeitpunkt nur von 60 auf 68 Monate verschoben wird, betragen die Kosten für die gewonnenen 7,7 Monate (wie errechnet) öS 7,3 MIO. Das sind ca. öS 1 MIO/Monat bzw. 12 MIO/Jahr (Kosten/a)! Bei einer derart ineffizienten (d.h. kostspieligen) Therapie wird die Frage nach deren Sinnhaftigkeit besonders virulent. Man wird überlegen müssen, ob der finanzielle Aufwand noch angemessen ist, oder ob nicht besser andere wirksamere medizinische Behandlungsmethoden vorrangig gefördert werden sollten (z.B. Diätprogramme).
In Tabelle V sind Kosten-Nutzen-Berechnungen von einigen weiteren medizinischen Maßnahmen angeführt. Insbesondere wurden auch chirurgische Interventionen zum Vergleich gegenübergestellt.
| Studie | NNT | LV | LVa | NNTa | Kosten/a |
|---|---|---|---|---|---|
| CARE29 | 500 : 1 | 8 Monate | 0,48 Tage | 750 : 1 | 12.000.000 |
| ISIS 430 | 200 : 1 | 56 Tage | 0,28 Tage | 1300 : 1 | 600.000 |
| Diast. RR (MRC)31 | Schlaganfall | ||||
| 105 mm Hg | 333 : 1 | 3 Monate | 0,3 Tage | 1330 : 1 | 10.000.000 |
| 95 mm Hg | 2000 : 1 | 1 Monat | 0,015 Tage | 24000 : 1 | 170.000.000 |
| Karotis-OP (Barnett)32 | Schlaganfall | ||||
| 50% - 70% | 75 : 1 | 3 Monate | 1,2 Tage | 300 : 1 | 6.000.000 |
| > 70% | 6 : 1 | 12 Monate | 60 Tage | 6 : 1 | 1.200.000 |
| Coronarchirurgie (Varnauskas)33 | 5 : 1 | 60 Monate | 12 Monate | 1 : 1 | 1.000.000 |
| Schrittmacher | 1 : 1 | normale (20 J.) Lebenserwartung | 20 Jahre | 1 : 1 | 15.000 (bei 20 J.) |
| Diabetes I (Insulin) | 1 : 1 | fast normale (50 J.) Lebenserwartung | 50 Jahre | 1 : 1 | 50.000 (bei 20 J.) |
| Pneumonie (Heilung) | 1 : 1 | normale (20 - 50 J.) Lebenserwartung | 20 - 50 J. | 0,05 : 1 | 1 |
Natürlich hängt die Bewertung der Effizienz stark von den wirtschaftlichen Möglichkeiten einer Gesellschaft ab. Es müßten jedenfalls auch hier Indikatoren entwickelt werden, die eine Abstufung der Effizienz ermöglichen, z.B. Humankapital-Ansatz34.
4. Bewertungskriterien der Verhältnismässigkeit
Das Problem, das sich ergibt ist, daß bisher keine ausreichenden Bewertungskriterien vorhanden sind, um die Verhältnismäßigkeit abzuschätzen. Es bedarf daher einer eingehenden Auseinandersetzung mit diesem Begriff. Dies ist auch notwendig, um den Übergang von einer primär kurativen Therapie zu einer rein palliativen Therapie besser begründen zu können bzw. um die Grenze zwischen gerechtfertigtem Behandlungsverzicht und Fahrlässigkeit (Vorenthalten einer Therapie) leichter ziehen zu können.
4.1 Verhältnismäßigkeitsindikatoren
Dabei bedarf es nicht nur der Quantifizierung von LQ, Nebenwirkungen und der Lebenserwartung, sondern darüber hinaus auch der Erarbeitung von Bezugsgrößen (Vergleichsdaten) aus dem Alltagsleben (epidemiologische und soziologische Studien), um diese bewerten zu können. Auf diese Weise könnte die Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme anhand von praktischen Beispielen für den Patienten einsichtig gemacht werden, denn letztlich wird er es selbst sein, der sich für oder gegen eine Therapie entscheidet.
Beispiel: Wie bereits erwähnt, kann durch Gehtraining die Lebenserwartung von 69-jährigen Männern von 5 auf 12 Jahre verlängert, also mehr als verdoppelt werden. Die Lebenserwartung von Rauchern ist um 7 - 10 Jahre kürzer als von Nichtrauchern. Dennoch rauchen immerhin noch 41% der Männer und 21% der Frauen35,<link typo3>36. In einer breit angelegten Interventionsstudie konnte die Anzahl der Zigarettenraucher durch eine gezielte Aufklärungskampagne nur um 4% gesenkt werden37. Nach Herzinfarkt beenden immerhin 40% das Rauchen. Offensichtlich wird die Aussicht auf Lebensverlängerung (oder -Verkürzung) angesichts des Todes ganz anders eingeschätzt, als wenn sie in ferner Zukunft relevant wird. Die psychologischen Ursachen eines solchen Verhaltens und die medizinisch-ethischen Konsequenzen daraus wären ein interessanter Forschungsbereich. So sind auch 23% der Bevölkerung übergewichtig, obwohl das Gesundheitsrisiko erheblich ist.
Interessant ist auch die höchst unterschiedliche Bewertung des relativen Risikos in verschiedenen Studien. So wird aufgrund einer Reduktion des relativen Risikos um 37%, nach 5 Jahren einen Herzinfarkt zu bekommen, eine Pravastatintherapie unbedingt empfohlen (CARE-Studie!).
Andererseits steigt das relative Risiko für Frauen unter einer postmenopausalen Hormontherapie nach 5 Jahren Brustkrebs zu bekommen um 46%, bei älteren Frauen (60a) sogar um 71%.38
Dennoch wird eine Hormontherapie (zur Osteoporoseprophylaxe und zur Hebung der LQ) bei postmenopausalen Frauen weltweit propagiert!
Zur Veranschaulichung dieser Überlegung soll noch ein eher unkonventionelles Beispiel angeführt werden:
Das Risiko einer Frau, im Laufe ihres Lebens Brustkrebs zu bekommen, beträgt 8:139,<link typo3>40. Durch eine beidseitige prophylaktische Mastektomie könnte dieses Risiko um 100%, d.h. auf Null reduziert werden. Die NNT würde 8:1 sein. Bei Patientinnen, die in der Verwandtschaft ein Mamma-Ca haben, ist das Risiko noch viel höher, die Effekttivität einer Mastektomie noch erheblich größer. Trotzdem wird die prophylaktische Mastektomie (z.B. bei allen Frauen über 45) nirgends in der Welt durchgeführt, was beweist, daß ganz offensichtlich auch höchst effektive Ergebnisse letztlich keine Bedeutung haben, wenn andere Faktoren ins Spiel kommen.
Wie bereits erwähnt, sind Lebensverlängerung und Lebensqualität nur relative und keine absoluten Werte. Deshalb wird ein erhöhtes Mortalitätsrisiko durchaus in Kauf genommen, wenn der "Preis" für eine Lebensverlängerung zu hoch wird (z.B. Verzicht auf Verkehrsmittel, Rauchen, gutes Essen, Freizeitsport; Berufsrisiko; Umweltschutz; Verlust der Brust).
Durch Gegenüberstellung solcher und ähnlicher epidemiologischer und soziologischer Vergleichsdaten könnten orientierende Meßzahlen (Indikatoren) erarbeitet werden, die ablesen lassen, welches Risiko man im allgemeinen noch als tolerabel ansieht, und ab wann eingreifende Maßnahmen (wie z.B. die Gabe von Medikamenten mit erheblichen Nebenwirkungen) akzeptiert bzw. sinnvollerweise empfohlen werden können. Jedenfalls scheint die Grenze im Prozent- und nicht im Promillebereich zu liegen (s. oben)41.
Die Maßstäbe der Verhältnismäßigkeit sind auch deshalb so wichtig, weil es nur so für den praktisch tätigen Arzt möglich sein wird, gut begründbare Prioritäten in seiner Behandlungsstrategie zu setzen.
4.2 Die Verhältnismäßigkeitsforschung
Das Prinzip Verhältnismäßigkeit ist freilich durch Richt- und Meßzahlen alleine nicht in den Griff zu bekommen, sondern es kann letztlich nur von ethischen Kriterien geleitet werden. Deshalb ist S.O.M. immer auch eine Herausforderung für die Ethik in der Medizin. Verhältnismäßigkeit ist in aller Munde, obwohl ihr Begriff noch sehr unscharf ist. In diesem Zusammenhang geht es in dem Projekt in erster Linie um eine Begriffsklärung. Dies ist eine wahre Herausforderung für die Ethik in der Medizin. Dabei geht es in erster Linie um eine Auseinandersetzung mit Begriffen wie Klugheitsentscheidung, Entscheidungsfreiheit, Verteilungsgerechtigkeit, Freiheit des Gewissens, Gemeinwohl, Einzelinteressen, Autonomie des Patienten usw.
Ganz allgemein kann vielleicht gesagt werden, daß die hier vorgelegten Daten die Vermutung nahelegen, daß eine Präventivmedizin, wie sie heute mit Hilfe aufwendiger statistischer Methoden in Multicenterstudien und Metaanalysen betrieben wird, möglicherweise ein Irrweg ist, und daß sich die moderne Medizin viel eher auf die Verbesserung der Lebensqualität unserer Patienten als auf marginale Erfolge zur Lebensverlängerung konzentrieren sollte.
5. S.O.M. - Stufenplan
Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich ein schrittweiser Stufenplan zur Entscheidungsfindung für eine sinnvolle Therapie (siehe Diagramm).
In Stufe 1 muß zunächst nach den Kriterien der Evidence Based Medicine untersucht werden, ob eine Therapie prinzipiell greifbar ist oder nicht. Wenn nein, so kann bereits auf eine palliative Therapie abgestellt werden. Wenn ja, muß noch durch die Zweckdienlichkeitsanalyse untersucht werden, ob auch die Zielparameter Heilung oder Lebensverlängerung prinzipiell erreicht werden können. Wenn ja, so muß in Stufe 2 deren Relevanz quantifiziert werden, um dann in Stufe 3 eine Verhältnismäßigkeitsanalyse durchführen zu können. Dabei wird letztlich entschieden, ob eine kurative, eine lebensverlängernde oder eine palliative Therapie für den je konkreten Patienten praktisch sinnvoll, d.h. hilfreich erscheint.
Dieser Stufenplan ist auch deshalb so wichtig, weil er hilft, die trügerischen Klippen einer überzogenen kurativen Medizin rechtzeitig zu erkennen, um den Gedanken, unbedingt zu heilen, aufzugeben, und sich der Palliativmedizin bzw. der Verbesserung der LQ zuzuwenden.
III. Nutzen der Sinnorientierten Medizin (S.O.M.)
Der primäre Nutzen des vorgelegten Konzepts einer Sinnorientierten Medizin (S.O.M.) besteht darin, die vorhandenen wissenschaftlichen Daten (EBM) für den praktisch tätigen Arzt so transparent zu machen, daß sinnlose Therapiemaßnahmen verhindert und die vorhandenen therapeutischen und ökonomischen Möglichkeiten für den Patienten optimal einsetzbar werden.
Dadurch könnte eine neue Ära innerhalb der gesamten Medizin eingeleitet werden. Diese Ära wäre primär gekennzeichnet durch ein schrittweises Umdenken von der Machbarkeit zur Sinnhaftigkeit bzw. vom Möglichen zum Nützlichen. Es käme zu einer verstärkten Konzentration der medizinischen Kräfte auf die Bedürfnisse des Patienten und seiner LQ. Dies würde bedeuten, daß der zunehmende Vertrauensverlust in die Schulmedizin wieder zurückgewonnen wird. Auf der anderen Seite könnte Kurpfuschern und Quacksalbern der Boden entzogen werden, was wohl im Gesamtinteresse der Bevölkerung liegt. Außerdem könnte das frühere hohe moralische Ansehen der Medizin wiedergewonnen werden.
Darüber hinaus hätte das Projekt eine erhebliche ökonomische Relevanz, die im Wechsel von der Machbarkeit zur Sinnhaftigkeit ein enormes Potential an Einsparungen enthält, wenn z.B. sinnlose Therapieverfahren rechtzeitig vermieden werden und auf eine in erster Linie palliative Behandlung abgestellt wird.
Das Projekt hat auch einen forensischen Aspekt. Zunehmend werden (nach amerikanischem Muster) Ärzte bei ungünstigem Krankheitsverlauf für eine eventuell nicht durchgeführte Therapie (z.B. Streptokinase-Behandlung bei Herzinfarkt) rechtlich belangt. Durch die kritiklose Propagierung bzw. Einforderung von uneffektiven Behandlungskonzepten kann der Arzt zunehmend unter Zugzwang kommen. Immer häufiger werden diagnostische und therapeutische Maßnahmen in erster Linie zur rechtlichen Absicherung des Arztes und weniger zum Wohl des Patienten (Sinnhaftigkeit) verordnet42. Auch aus diesen Gründen ist die Transparentmachung der Relevanz bzw. Sinnhaftigkeit einer Therapie notwendig.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die sinnorientierte Medizin (S.O.M.) eine Integration von EBM mit individueller klinischer Expertise und ärztlicher Erfahrung anstrebt.
Sie soll eine Entscheidungshilfe für eine maßgeschneiderte, auf den je einzelnen Patienten bezogene Medizin schaffen, die sich an dem Ethos der hippokratischen Einfachheit orientiert.
Nutznießer des vorgelegten Projektes könnten sein:
- Der mündige Patient
Durch die Transparenz der Daten kann eine offene und gemeinsame Entscheidungsfindung in einer partnerschaftlichen Arzt-Patienten-Beziehung erfolgen. Der Patient kann von unnötigen diagnostischen und therapeutischen Belastungen verschont werden. Auf der anderen Seite können ihm sinnvolle und effektive Behandlungsstrategien nicht vorenthalten werden, wenn sie als solche genau definiert sind. - Der Arzt
Für den Arzt, der heute durch eine zum Teil überbordende Datenflut verunsichert und teilweise unter einem kollektiven Handlungs- und Behandlungszwang gestellt wird, bringt die S.O.M. eine Vereinfachung und Erleichterung seines ärztlichen Tuns im Sinne einer individuellen patientenorientierten Medizin. Durch die Individualisierung der endgültigen Entscheidungsfindung im Sinne ärztlicher Kunst könnte die Gefahr einer überzogenen Reglementierung ärztlicher Entscheidung durch Gesundheitsgremien aller Art gebannt werden. - Die Zulassungsbehörde
Den Gremien, die für die Zulassung von Medikamenten verantwortlich sind, können hilfreiche Entscheidungskriterien geliefert werden. - Die Krankenkassen
Auch den Krankenkassen können Argumente bzw. Kriterien für sinnvolle Bewilligungen von Medikamenten, diagnostischen Maßnahmen, Therapiekonzepten usw. zur Verfügung gestellt werden. - Die Gesundheitspolitik
Weiters soll auch eine begründbare Rationalität bei der Verteilung der verfügbaren Ressourcen erreicht werden, sodaß die Einsparung von unnötigen Kosten letztlich zu einer besseren gesundheitlichen Betreuung der Gesamtbevölkerung führt. - Die pharmazeutische Industrie
Für die pharmazeutische Forschung sind die Kriterien des S.O.M. insoferne von erheblicher Bedeutung als gerade die Planung von Multicenterstudien nur dann sinnvoll erscheint, wenn die geplanten Fallzahlen nicht nur Signifikanzen, sondern auch Relevanz erwarten lassen. - Die medizinische Wissenschaft
Die Zielrichtung der medizinischen Forschung könnte insofern beeinflußt werden, als sie sich weniger an theoretischen Fragestellungen und dafür mehr an den Bedürfnissen des Patienten zu orientieren hätte. Insbesondere müßte sie sich stärker mit der Problematik der Nebenwirkung in einer Therapie und vorrangig mit der Verbesserung der LQ durch eine Behandlung auseinandersetzen, während die Erreichung von marginalen Erfolgen zur LV zweitrangig wäre.
Anhang: Abkürzungen
A = Ansprechrate
EBM = Evidence Based Medicine
gA = geringe Erfolgsaussicht
hA = hohe Erfolgsaussicht
HL = Heilung, Heilbehandlung
I = Indikatoren
kA = keine Erfolgsaussicht
LE = Lebenserwartung
LQ = Lebensqualität
LV = Lebensverlängerung
LVa = Durchschnittliche LV nach einem Behandlungsjahr (Patientenjahr)
LVi = rechnerische Lebensverlängerung bezogen auf die LE des einzelnen Patienten
mA = mäßige Erfolgsaussicht
NNTa = number of years needed to treat in order to gain an additional year
NNH = number needed to harm
NNT = number needed to treat
Nw = Nebenwirkung(en)
O = Objektive Faktoren der Verhältnismäßigkeit
Ö = Ökonomie (Effizienz)
Q = Quantifizierungsparameter
R = Relevanz(analyse)
Rk = Risiko
S = Subjektive Faktoren der Verhältnismäßigkeit
S.O.M. = Sinnorientierte Medizin, Sense Oriented Medicine
ÜLZ = Überlebenszeit
V = Verhältnismäßigkeit(sanalyse)
Referenzen
- Hense H. W., Antes G., Zeitschrift für Cardiologie 1997, 86: 313-319
- Fletcher S. W., Flecher R. H., Development of clinical guidelines, The Lancet 1998, 352: 1876
- Kopelman L.M., Conceptual and moral disputes about futile and useful treatments, The Journal of Medicine and Philosophy 1995, 20: 109-21
- Lange St., Statistisch signifikant - auch relevant für den Patienten? Medizinische Klinik 1998, 94 (Supplement II): 22-24
- Indirekt ist auch die Prävention durch diese drei Kriterien abgedeckt.
- Fleming T. R., De Mets D. L., Surrogate and points in clinical trials: Are we being misled? AnnInternMed 1996, 125: 605-13
- Roden Dan M., Risks and benefits of antiarhythmic therapy, New England Journal of Medicine 1994, 331: 785-791
- Schmoll H. J. et al, Kompendium internistische Ontologie, Springer, 1997: 662-3
- Fuchs C. S., Mayer R. J., New England Journal of Medicine 1995, 333: 32-41
- z.B. De Vita V.T., CANCER.. Principles and Practice of Oncology, Lippincott-Raven Publishers, 1997: 1048
- PRISM-Plus-Study Investigators, Inhibition of the platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor with tirofiban in unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction, New England Journal of Medicine 1998, 338: 1488-1497
- Tu J.V. et al., New England Journal of Medicine 1997, 336: 1500-1505
- Heilung (HL) kann auf optimale LV und LQ reduziert werden und wird deshalb in der Folge nicht als eigener Zielparameter ausgewiesen.
- NNT= number needed to treat. Dieser Ausdruck wird später näher erklärt.
- CARE Studie, New England Journal of Medicine 1996, 335: 1001-1009
- 70th Scientific Session, November 1997, Orlando, Florida
- Rothwell P. M., The Lancet 1995, 345: 1616-1619
- MRC, Trial of treatment of mild hypertension: principal results, BrMedJ 1985, 291: 97
- Schmoll, Kompendium ...S. 959, ISIS 4-Studie ... S. 658
- ISIS 4 Studie, The Lancet 1995, 345: 669-681
- Hakim A.A. et al, New England Journal of Medicine 1998, 338: 94-99
- Schmoll, Kompendium ... S. 958-959
- Bonadonna G., New England Journal of Medicine 1995, 332: 901-906
- Harris J.R. et al., Breast cancer (First of Three Parts), New England Journal of Medicine 1992, 327: 319-328
- Mast 1 Studie, The Lancet 1995, 346: 1509-1514
- De Vita , CANCER .... S. 1597, Schmoll, Kompendium...S. 960 ff
- So muß z.B. überprüft werden, ob eine ins Auge gefaßte Therapie - auch wenn sie theoretisch wirksam ist -bei dem jeweiligen Patienten praktisch noch zum Tragen kommen kann. Es gibt Behandlungsstrategien - insbesondere in der Präventivmedizin - die sich erst nach mehreren Jahren, z.B. auf die Überlebensrate signifikant auswirken. Wenn diese Zeitspanne größer ist als die individuelle Lebenserwartung des Patienten, dann ist eine solche Therapie sinnlos (z.B. Cholesterinsenkung bei einem 80-jährigen Patienten).
- Vgl. Lenzhofer K., Prat E., Imago Hominis 1997, IV/ 3: 173-198
- ibidem
- Roden, Risks and benefits ... S. 785-791
- MRC, Trial of treatment ... S. 97
- Barnett J.M. et al., Benefit of carotid endarterectomy in patients with symptomatic moderate or severe stenosis, New England Journal of Medicine 1998, 339: 1415-25
- Varnauskas E., Survival, myocardial infarction, and employment status in a prospective, randomized study of coronary bypass surgery, Circulation 72 [Suppl. V] 1985: 90
- vgl. Breyer F., Zweifel P., Gesundheitsökonomie, Springer, 1997: 29-30
- WHO, Editorial, Tobacco alert 1995
- Rich-Edwards Janet W. et al., The primary prevention of coronary heart disease in women, NEnglJMed 1995, 332: 1758-1766
- Family Heart Study Group, British Medical Journal 1994, 308: 313
- Colditz et al., New England Journal of Medicine 1995, 332: 1589-93
- Harris, Breast cancer ... S. 319-328
- Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group, Tamoxigen for early breast cancer: an overview of the randomised trials, The Lancet 1998, 351: 1451-67
- Die Wahrscheinlichkeit, z.B. bei einem Autounfall zu verunglücken, liegt bei 1% im Jahr (vgl. Gesundheitswesen in Österreich, 1998, Seite 22). Deshalb verzichtet jedoch niemand auf dieses Verkehrsmittel. Das Unfallrisiko beim Fußballspiel beträgt 4,1% (vgl. Unfallstatistik 1995, Institut SICHER LEBEN).
- Wenn man durch die Verabreichung eines ACE-Hemmers tatsächlich Leben "retten" könnte, dann wäre die Verabsäumung einer solchen Behandlung tatsächlich als schwerer Kunstfehler zu ahnden.
Univ.-Prof. Dr. Johannes Bonelli, Krankenhaus St. Elisabeth, Landstraßer Hauptstraße 4a, A-1030 Wien
Prof. Dr. Enrique H. Prat, Landstraßer Hauptstraße 4/13, A-1030 Wien