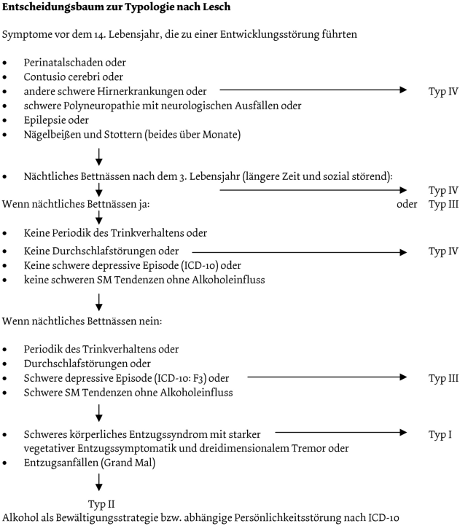Die Diagnose Abhängigkeit – eine Krankheit?
Zusammenfassung
Abhängigkeitserkrankungen sind als chronische Prozesse zu sehen, die äußerst heterogene Ursachen haben, und auch deren Folgen sind bei ein und demselben Suchtmittel sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die führenden Symptome sind Kontrollverlust, Toleranzausbildung, Craving, Entzugserscheinungen und Folgekrankheiten. Es werden die spezifischen psychotherapeutischen und medikamentösen Therapiekonzepte nach der Typoplogie des Autors vorgestellt. Es wird klar dargestellt, dass nur der Typ I in der Abstinenz und der Typ II im Bezug auf die psychotherapeutische Behandlung willentlich frei entscheiden können. Alle anderen Untergruppen von Alkoholkranken (z. B. Typ I im Entzug, Typ III in der schweren Depression mit Alkohol als Eigentherapie oder Typ IV Patienten) erreichen Psychosewert und können damit ihre Handlungen, insbesondere ihr Trinkverhalten nicht frei bestimmen. Wir konnten zeigen, dass die nach diesen Typologien spezifizierten Therapien die Prognose deutlich verbesserten. Es ist zu hoffen, dass ähnliche Therapievorschläge bald auch in den anderen Abhängigkeiten vorliegen. Abhängigkeiten sind Erkrankungen mit psycho-sozio-biologischen Faktoren. Die wissenschaftlichen Daten sind heute so gut fundiert, dass ideologische Betrachtungen und moralische Entwertungen keinen Platz mehr haben sollten.
Schlüsselwörter: Alkohol, Abhängigkeit, Typologie nach Lesch
Abstract
Addiction is a chronic process with heterogeneous etiologies and with significantly different substance-releated disabilities. The most common symptoms are loss of control, tolerance, craving, withdrawal and disabilities. In this article psychotherapeutic and medical therapeutic strategies according to Lesch’s Typology are presented. It can be clearly shown, that only Type I patients during sobriety and Type II patients with regard to psychotherapy are able to decide on their own will. All other subgroups of alcohol dependent patients (e. g. Type I during withdrawal, Type III in stages of major depression with alcohol abuse or Type IV patients) are so severely disturbed, that they cannot decide freely also relating to their drinking behaviour. We could show that those specific therapeutic approaches based on this Typology improve significantly the long term course. We hope that similar approaches are developed in the treatment of other addictions. Addiction as a disease with psycho-social-biological symptoms is scientifically so well established, that ideological considerations and moral devaluations are no longer suitable.
Keywords: Alcohol, Addiction, Lesch Typology
1. Einleitung
Suchtmittel sind Pflanzen oder werden aus Pflanzen extrahiert. Sie sind älter als die Menschheit. Seit Tausenden von Jahren wurden Suchtmittel in der Heilkunde verwendet und praktisch jede Kultur entwickelte klare Regeln, unter welchen Bedingungen es erlaubt war, Suchtmittel einzunehmen. Die Friedenspfeife der Indianer, die Trinkgelage in der mexikanischen Kultur oder das Ayahuaskaritual der Amazonas-Schamanen sind Beispiele für diese Rituale. Alle Suchtmittel folgen pharmakologischen Regeln. Die Dosis, der Wirkungsgrad, die Häufigkeit der Einnahme und die Sensitivität der einnehmenden Person bestimmen die Wirkungen, die Nebenwirkungen und auch die Gefahr einer Abhängigkeitsentwicklung. Vulnerabilitäten in den Hirnfunktionen, in der Chronobiologie und auch in allen Körperfunktionen sind deutlich wichtiger für eine Abhängigkeitsentwicklung, als dies für die Wirkung des Suchtmittels festzuhalten ist. Psychologische Traumatisierungen und schwere soziale Belastungen führen oft zu einer Lebensqualität, die ohne Suchtmittel nicht zu ertragen ist. Wie wir aus der Schmerztherapie wissen und wie wir auch aus der Behandlung der kindlichen Epilepsie erkennen konnten, führen bei richtiger Indikation weder die Opiate in der Schmerztherapie noch die Benzodiazepine in der Epilepsiebehandlung zu Abhängigkeitserkrankungen.
Aus moderner psychiatrischer Sicht sollten Abhängigkeitserkrankungen etwa so gesehen werden wie chronische somatische Erkrankungen. Ein Beispiel hierfür wäre der Diabetes mellitus, der auch eine Erkrankung des Stoffwechsels ist, wobei diese Stoffwechselstörung genetisch, toxisch oder auch durch falsche Ernährung (Übergewicht) ausgelöst sein kann. Zucker ist für einen Diabetiker in zu hoher Dosierung genauso gefährlich wie eine Unterzuckerung, die zu schweren körperlichen und psychischen Beschwerdebildern führt (z. B. Grand Mal Anfälle). Sehr ähnlich ist auch die Entwicklung der Abhängigkeitserkrankungen zu sehen. Uexküll hat schon in seinem Lehrbuch psycho-somatische Medizin (1996) dargestellt, dass chronische Erkrankungen zu typischen Interaktionen mit der sozialen Umgebung führen.1 Vor allem Therapeuten (Ärzte, Pfleger, Psychologen, Sozialarbeiter usw.) erwarten vielfach zu optimistische Ziele und zeigen deshalb oft auch deutliche aggressive Übertragungen in die Therapie, welche die Therapie stören, wobei diese Aggressionen oft den Patienten ungerechtfertigt zugeordnet werden.
In der heutigen Gesellschaft werden gültige Rituale verlassen. Vor allem in Europa und in Nordamerika besteht eine Wohlstandsgesellschaft, die gewohnt ist, sich fast alles leisten zu können. Die Solidarität innerhalb dieser Gesellschaften hat sich deutlich reduziert. Oft wissen die heutigen Menschen nur sehr wenig von ihrer sozialen Umgebung. Man kennt die Nachbarn kaum, man weiß nichts von seinen MitarbeiterInnen. Lehrer kennen kaum ihre Schüler. Die leichte Erreichbarkeit von stark wirksamen Suchtmitteln und die Akzeptanz von Tabak und Alkohol als Genussmittel machen es vielen Jugendlichen schwer, auf Suchtmittel zu verzichten. In diesem Artikel möchte ich auf die Ursachen, die Diagnose und auf die Therapie einer Abhängigkeitsentwicklung eingehen und einige heute gültige Strategien zur Prävention, zur Erkennung und zur Therapie festhalten. Da die Heterogenität der Abhängigkeitserkrankungen heute unbestritten ist, werde ich die vorher genannten Bereiche nach der von mir vorgeschlagenen Typologie darstellen.2 Diese Heterogenität wurde auch in der Tabakabhängigkeit bestätigt, auch in der Abhängigkeit von Opiaten wurden ähnliche Untergruppen definiert. Die Erfassung des Schweregrades des Entzugsyndroms macht allerdings bei unterschiedlichen Suchtmitteln auch unterschiedliche Probleme (z. B. ist die Erfassung des Alkoholentzugsyndroms einfach und gut objektivierbar, während bei der Erfassung des Tabakentzugsyndroms kein gutes Instrument vorliegt). Die unterschiedlichen Folgekrankheiten lassen es sinnvoll erscheinen, in der Diagnostik (nach ICD 10 oder DSM IV) nach der Diagnose Abhängigkeit auch die Art des Suchtmittels zu kodieren.3 Vor allem bei Opiatabhängigen bewirkt der meist hohe Beigebrauch von Benzodiazepinen oft schwere Entzugsyndrome und auch epileptische Entzugsanfälle, so dass bei Opiatabhängigen oft nur drei Gruppen unterschieden werden können.
2. Ursachen von Suchtentwicklung
Die Entwicklung einer Abhängigkeitserkrankung wird heute am besten in einem Trichtermodell dargestellt (Abb. 1).4
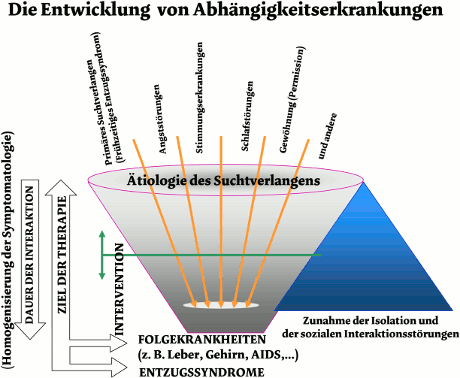
Am Beginn jeder Abhängigkeitsentwicklung findet sich die Tatsache, dass die Wirkung des Suchtmittels sehr rasch als angenehm erlebt werden muss. Nur der Erstkonsum wird meist negativ erlebt. Die Peer-Group verstärkt oft den Wunsch, ein Suchtmittel zu nehmen, schon nach kurzer Zeit wird die Einnahme als positiv erlebt. Dies heißt, dass die pharmakologische Wirkung des Suchtmittels zu der biologischen Vulnerabilität passt (Schlüssel-Schloss-Prinzip). Die Bedingungen, die zu einem Suchtmittelgebrauch führen, sind äußerst heterogen. Deshalb ist der Eingang des Trichters in Abb. 1 auch sehr breit dargestellt (z. B. Angst, Kontaktproblem, Mutfragen, Depressionen, gewünschtes Verhalten in der Gruppe und vieles andere).
Kommt es zu einem häufigen Konsum, pendelt der Betroffene oft viele Jahre zwischen Vergiftung und Entzug. Folgeerscheinungen treten auf, ein gewisser Prozentsatz entwickelt auch Symptome, die als Entzugssymptome zu definieren sind. Alkohol bewirkt vor allem kognitive Störungen. Es kommt zur Abnahme von Intelligenzfunktionen wie zum Beispiel Kreativität, Phantasie und Kritikfähigkeit. Abhängige von Alkohol oder von illegalen Drogen werden von ihrer Umgebung dann häufig abgelehnt. Die Folge ist zunehmende Isolation. Je später man Patienten mit dieser Suchtentwicklung kennen lernt, umso mehr imponieren die Vergiftung, die Folgekrankheiten, die Entzugssyndrome und die soziale Isolation. Umso ähnlicher werden sich diese Patienten in ihrem Krankheitsbild, Verhalten, in ihren Reaktionen und Symptomen.
Die Diagnosen nach ICD 10 und DSM IV beschreiben diese Erscheinungsbilder, berücksichtigen aber viel zu wenig die unterschiedlichen Ätiologien und die primären Persönlichkeitszüge.5 Erst nach Tagen oder einigen Wochen Abstinenz bilden sich diese Folgeerscheinungen zurück und es treten Persönlichkeitsmerkmale in den Vordergrund, die dann eine psychotherapeutische Bearbeitung der Grundproblematik ermöglichen. Erst in diesem Zustand ist ein Patient paktfähig. Langfristige Therapieziele können jetzt rational so definiert werden, dass sie sowohl vom Patienten als auch vom Therapeuten akzeptiert werden.
Spezifische psychologische und biologische Modelle zur Ätiologie wurden entwickelt und haben für die Prävention auch ihre Bedeutung. Zu spezifischen therapeutischen Strategien, die diese psychologischen Ätiologiemodelle berücksichtigen, ist es aber bis heute nicht gekommen. Die biologische primäre Vulnerabilität, die vor allem die Belohnungssysteme betrifft, hat sowohl präventive wie auch therapeutische Bedeutung (medikamentöse Entzugsbehandlung und medikamentöse Rückfallprophylaxe).
Biologische Erklärungsmodelle beleuchten häufig nur einzelne Systeme (serotonerg, dopaminerg, das Opiatsystem, den Cannabisrezeptor usw.). Diese Sichtweise ist viel zu einfach, weil diese Systeme in verschiedenen Regionen des Gehirns zusammenspielen und auch die Hypophysen-Schilddrüsenachse mit dem Fettstoffwechsel massive Einflüsse auf die Hirnaktivitäten hat. Gefühle und Belohnungen, aber sogar Leistungen des Gehirns sind deutlich verändert, wenn eine hypothyreotische Stoffwechsellage oder ein BMI über 33 festzustellen ist. Erlebnisse (im positiven wie im negativen Sinne) aktivieren diese Regelkreise und stabilisieren damit auch die Schilddrüsenachse und die Rhythmik von Stoffwechselprozessen.
Ein sehr vereinfachtes Modell dieser cerebralen Regelkreise haben W. Sieghart und B. Johnson entwickelt. Johnson hat dieses Modell dann auf die Entstehung von Abhängigkeitsprozessen und auf das Verlangen angewandt.6
2003 publizierten Johnson et al. den wichtigsten Regelkreis für die medikamentöse Therapie dieses auf Craving adaptierte Belohnungssystem und stellte vor allem die Interaktionen zwischen Nucleus accumbens, ventralem Tegmentum und Kortex dar.7 Die primäre Emotionslage wird durch die Aktivität des Nucleus accumbens bestimmt. Durch frontobasale Hirnregionen nehmen wir Eindrücke auf und entwickeln Erwartungen in Bezug auf die Wirkung des Suchtmittels, welche dann als angenehm, erstrebenswert oder auch abzulehnend bewertet werden. Diese Funktionen werden dem ventralen Tegmentum zugeschrieben. Erlebnisse werden vor allem im Hippokampus verarbeitet, diese Verarbeitungsprozesse aktivieren den Nucleus accumbens und beeinflussen damit das jetzige Erleben und Verarbeiten von frontalen Wahrnehmungen.
Auf dieses System (Nucleus accumbens - ventrales Tegmentum) rückwirkend ist die Erwartungshaltung (was erwarte ich mir von der Einnahme einer Substanz) zu sehen. Dies geschieht mit Bahnen, die von frontobasalen Bereichen zum Nucleus accumbens führen. Die Modulation dieses Systems durch gabaerge Funktionen des Temporallappens wird in diesem System noch zu wenig berücksichtigt. Zyklothyme Temperamente scheinen aber nicht nur mit frontalen Funktionen, sondern auch mit temporalen Funktionen in Einklang zu stehen. Frühkindliche cerebrale Schädigungen sind häufig temporal, aber auch frontal gelegen, und führen dann später zu zyklothymen Temperamenten mit entsprechenden reduzierten Impulskontrollen (Abb. 2).
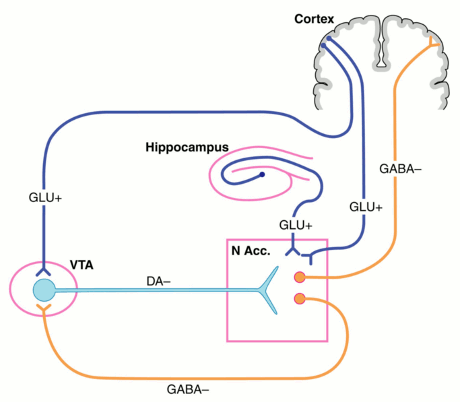
3. Die Diagnose Abhängigkeitserkrankungen (ICD 10)8
In der psychiatrischen Klassifikation unterscheidet man den „Missbrauch“ vom „Abhängigkeitssyndrom“. In Europa hat sich vor allem das ICD 10, das von der WHO entwickelt wurde, durchgesetzt. Da der Missbrauch ein sehr heterogenes Phänomen ist, kulturell in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich gesehen wird und sehr selten in die Diagnose Abhängigkeit übergeht, wird in diesem Artikel auf den Missbrauch nicht weiter eingegangen. Es ist auch international akzeptiert, dass die Behandlung des Missbrauches sich nach der Persönlichkeit und den sozialen Interaktionen richtet und deshalb keine Richtlinien für die Therapie des Missbrauchs bestehen. Spielsucht, Arbeitssucht, usw. werden wie alle nicht stoffgebundenen Suchtformen in diesem Artikel nicht berücksichtigt, weil sie im ICD 10 explizit nicht bei den Abhängigkeitskrankheiten erfasst werden, sondern bei den Persönlichkeitsstörungen kodiert werden sollten. Im ICD 11 ist eine eigene Kategorie „Impulskontrollstörungen“ für diese Suchtformen in Diskussion.9
3a. Das Abhängigkeitssyndrom F10.2 oder F17.2 (im ICD-10)
Diagnostische Leitlinien:
Die sichere Diagnose „Abhängigkeit“ sollte nur gestellt werden, wenn irgendwann während des letzten Jahres drei oder mehr der folgenden Kriterien gleichzeitig vorhanden waren:
- ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, psychotrope Substanzen wie z. B. Tabak und/oder Alkohol zu konsumieren;
- verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Tabak- und Alkoholkonsums;
- ein körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums, nachgewiesen durch die substanzspezifischen Entzugssymptome oder durch die Aufnahme der gleichen oder einer nahe verwandten Substanz, um Entzugssymptome zu mildern oder zu vermeiden;
- Nachweis einer Toleranz; um die ursprünglich durch niedrigere Dosen erreichten Wirkungen der psychotropen Substanz hervorzurufen, sind zunehmend höhere Dosen erforderlich (eindeutige Beispiele hierfür sind die Tagesdosen von Alkohol- und Opiatabhängigen, die bei Konsumenten ohne Toleranzentwicklung zu einer schweren Beeinträchtigung oder sogar zum Tode führen würden);
- fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen zugunsten des Substanzkonsums, erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu beschaffen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen;
- anhaltender Substanzkonsum trotz Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen, wie z. B. Leberschädigung durch exzessives Trinken, depressive Verstimmungen infolge starken Substanzkonsums oder Rauchen trotz schwerer Lungenerkrankung. Es sollte dabei festgestellt werden, dass der Konsument sich tatsächlich über Art und Ausmaß der schädlichen Folgen im Klaren war oder dass zumindest davon auszugehen ist.
Ein eingeengtes Verhaltensmuster im Umgang mit Alkohol und Tabak wird ebenfalls als charakteristisches Merkmal beschrieben. Ein aktueller Konsum oder ein starker Wunsch nach Tabak und Alkohol wird oft als innerer Zwang erlebt und erst bewusst, wenn versucht wird, den Konsum zu beenden oder zu kontrollieren. Das Abhängigkeitssyndrom kann sich nur auf Alkohol oder Tabak beziehen, aber es kann auch mit anderen Suchtmitteln kombiniert auftreten, z. B. Tabak, Alkohol, Beruhigungsmittel und vielleicht auch Cannabis.
Je nach Suchtmittel entwickeln die Patienten unterschiedliche und unterschiedlich häufig Entzugssyndrome. In der Tabakabhängigkeit sind vor allem Ungeduld und Stimmungsverschiebungen die führenden Symptome, während in der Alkoholabhängigkeit Tremor, Hyperhydrosis und Unruhe häufig zu beobachten sind. Nach dem Absetzen von chronisch eingenommenen Amphetaminen und/oder Kokain finden sich chronifizierte depressive Syndrome über Monate, die oft therapieresistent sind. Opiate führen im Entzug bis zu drei Tagen zu schweren Schmerzsyndromen und zu den entsprechenden Magen-Darm-Beschwerden. Auch die Temperaturempfindungen sind massiv verändert (der von innen frierende Patient). Beruhigungsmittelabhängigkeit führt zu schweren Angstzuständen, zu Schlafstörungen und auch zu massiver Unruhe, oft auch kombiniert mit epileptischen Entzugsanfällen. Diese Symptomatik besteht über Wochen und beginnt bereits bei einer Dosisreduktion und nicht erst beim Absetzen der Medikation. Von Entzugserscheinungen sollte man aber erst dann sprechen, wenn die ICD-Kriterien erfüllt sind.
3b Das Entzugssyndrom (ICD-10: F10.3)
Diagnostische Leitlinien:
Das Entzugssyndrom ist einer der Indikatoren des Abhängigkeitssyndroms. In der Akutsituation ist auch diese Diagnose äußerst wichtig. Das Entzugssyndrom soll als Hauptdiagnose dann diagnostiziert werden, wenn es Grund für die gegenwärtige Konsultation ist und wenn das Erscheinungsbild so schwer ist, dass es eine besondere medizinische Behandlung erfordert.
Die körperlichen Symptome sind je nach verwendeter Substanz unterschiedlich. Häufige Merkmale sind auch psychische Störungen (z. B. Angst, Depression und Schlafstörungen). Typischerweise berichten die Patienten, dass sich die Entzugssymptome durch die erneute Zufuhr der Substanz bessern.
Es ist auch daran zu denken, dass Entzugssyndrome durch konditionierte Reize ohne unmittelbar vorhergehende Substanzzufuhr ausgelöst werden können. In solchen Fällen ist ein Entzugssyndrom nur dann zu diagnostizieren, wenn der Schweregrad dies rechtfertigt.
Es ist noch zu differenzieren, ob dieses Entzugssyndrom mit oder ohne Krampfanfälle bzw. mit oder ohne Delirium tremens abläuft.
4. Untergruppen von Abhängigkeitserkrankungen
Seit mehr als 100 Jahren werden Untergruppen von Abhängigen als Typologien oder als Komorbiditäten (primäre Abhängigkeit vs. Symptomatische Abhängigkeit) entwickelt. In der Alkoholabhängigkeit und in der Tabakabhängigkeit haben einige von ihnen auch therapeutische Relevanz entwickelt. In der Opiatabhängigkeit hat die Forschungsgruppe um Peter Hermann vielversprechende Ansätze entwickelt, während in den anderen Abhängigkeiten (Amphetamine, Kokain, Cannabis) spezifische Instrumente zur Definition von Untergruppen fehlen und auch keine spezifischen therapeutischen Angebote im Bezug auf solche Untergruppen angeboten werden können.10
4a Die 4-Cluster Lösung
Jellinek kommt das Verdienst zu, Untergruppen von Alkoholabhängigen in die internationale Literatur eingeführt zu haben, allerdings hat seine Einteilung nur mehr historisches Interesse.11 Die Typologien, die heute Eingang in die Therapie gefunden haben, sind jene von Cloninger, Babor und Lesch.12 Auch der Beginn der Alkoholabhängigkeit (vor oder nach dem 25. Lebensjahr) scheint für die Therapie wichtig zu sein. Naltrexon wird in der Rückfallprophylaxe nur beim Typ A nach Babor, beim Typ II nach Cloninger und beim Typ III und IV nach Lesch empfohlen. Acamprosat reduziert die Rückfälle bei Cloninger Typ II und Lesch Typ I und Typ II. Ondansetron wirkt rückfallprophylaktisch bei einem Beginn der Alkoholabhängigkeit vor dem 25. Lebensjahr und bei Babor Typ B. Sertraline hat nur bei Babor Typ A positive Daten zur Rückfallprophylaxe.13
Hesselbrock hat in ihrem Artikel über Untergruppen von Alkoholabhängigen herausgearbeitet, dass eine 4-Cluster Lösung mit einem multidimensionellen Ansatz, wie sie die Typologie nach Lesch aufweist, der beste Weg zu einer empirisch unterstützten Einteilung mit Therapierelevanz ist.
Ähnliche Untergruppen fanden sich in der Tabakabhängigkeit. Peter Hermann konnte in mehr als 900 Opiatabhängigen ebenso den Typ III und den Typ IV nach Lesch finden. In den Opiatabhängigen konnte er den Typ I und den Typ II nach Lesch nicht trennen, weil der Schweregrad der Entzugssymptomatik vor allem vom Beigebrauch mit Benzodiazepinen abhängt und nicht von den Opiaten.14
Da für die Tabakabhängigkeit noch keine Therapiestudien zu den vier Gruppen vorliegen bzw. auch keine Therapiestudien zu den Untergruppen von Opiatabhängigkeiten vorliegen, werden die Untergruppen nur bei der Alkoholabhängigkeit genau dargestellt. Bei allen anderen Suchtmitteln fehlen Studien zur genaueren Diagnostik.
5. Diagnose und Prognose nach der Typologie nach Lesch und ihre spezifische Therapie15
Die Diagnose erfolgt mittels der Gewichtung von affektiven Störungen, Symptomen, die man erfragt, und von Erkrankungen, wie man sie in der Psychiatrie (affektive Störungen, ICD10-F3) und in der Neurologie (Polyneuropathie, Anfälle) erfasst. Die Symptome sind in einem Entscheidungsbaum zusammengefasst und werden in einem Computerprogramm in den meisten europäischen Sprachen angeboten (LAT-Online.at). Dieses strukturierte Interview erlaubt nicht nur die Zuordnung zur Typologie, sondern gibt ein Gesamtbild des Patienten, welches man für die Motivation, die Entzugsbehandlung, für das „Cut-Down-Drinking“, für die Rückfallprophylaxe, aber auch für die Prognose, z. B. für forensische Aspekte, braucht (Abb. 3).
5a Typ I – Diagnose – Motivation – Therapie (Allergiemodell)
Der hohe Trinkdruck unserer Gesellschaft führt dazu, dass 30% der erwachsenen Männer und etwa 10% der erwachsenen Frauen einen chronischen Alkoholmissbrauch betreiben. 4% der Bevölkerung haben aber eine erhöhte Vulnerabilität auf Alkohol (genetisch, toxisch oft schon im Mutterleib, usw.) und entwickeln dann eine biologische Überempfindlichkeit auf Alkohol. Sie trinken meist sehr große Mengen und wagen es dann nicht, aufzuhören, weil sie sich vor ihren Entzugsyndromen fürchten.
Während der Abstinenz haben sie kein wesentliches Alkoholverlangen und keine psychiatrischen Auffälligkeiten. Wenn sie aber situationsabhängig geringe Mengen Alkohol trinken, entwickeln sie eine „Gier“ nach Alkohol. Die Patienten beschreiben oft, dass sie das Gefühl haben, dass sich in ihrem Gehirn „ein Schalter umlegt“. Diese Gruppe entwickelt häufig schon nach kurzer Zeit schwere Entzugserscheinungen, manchmal auch Entzugsanfälle (epileptische Anfälle, Typ Grand Mal am ersten oder zweiten Tag nach Trinkmengenveränderungen oder Abstinenz).
Biologische Korrelate
Der Alkoholabbau bei dieser Gruppe unterscheidet sich wesentlich von dem der anderen drei Gruppen. Bei diesen Patienten wird Methanol signifikant rascher eliminiert als bei den anderen drei Typen. Dies führt zu hoher Aldehydbildung, was zu dem unten beschriebenen Erscheinungsbild des Entzuges bei Typ I Patienten führt. Hierbei sind Aldehyde das toxische Agens. Darüber hinaus werden durch Kondensation von Dopamin und Aldehyden vermehrt Tetraisoquinoline (TIQs) gebildet, die für das Auftreten alkoholinduzierter Gier verantwortlich sein könnten.16 Homocystein ist im Alkoholentzug nur in dieser Untergruppe signifikant erhöht.17
Auch nach langer Abstinenz (über Jahre) bleibt die Vulnerabilität dieses Systems bestehen, so dass jeder Rückfall auch nach langen Abstinenzperioden ein massives Alkoholverlangen auslöst.
Nikotinabhängige dieser Gruppe rauchen Fagerström positiv (≥ 5), zeigen eine starke somatische Abhängigkeit und schwere somatische Entzugssyndrome.18
Therapie des Typ I
Diese Untergruppe benötigt keine wesentliche psychotherapeutische Betreuung. Die Aufklärung über die Krankheit steht im Vordergrund. Da die Stärke des Verlangens mit dem Schweregrad und der Häufigkeit der erlebten Entzüge oder Entzugsanfälle korreliert, ist es wichtig, eine suffiziente Entzugbehandlung durchzuführen. In Trinkepisoden oder während dieser schweren Entzüge sollte der Patient liebevoll begleitet werden. In Trinkepisoden ist der Patient schwer krank und kann oft das Trinkverhalten willentlich nicht steuern. Wenn er einige Tage abstinent ist und das Entzugssyndrom abgeklungen ist, besteht oft noch eine deutliche kognitive Beeinträchtigung, die aber nach sechs Wochen abklingt. Die Patienten sind vom Temperament aus dann hyperthym und versuchen alles in der Trinkphase versäumte wieder aufzuholen. In der therapeutischen Begleitung sollte man diese Ungeduld bremsen, aber dem Patienten sehr deutlich mitteilen, dass jedes neuerliche Trinken sehr rasch die Gier auslöst und in der vollen Verantwortung des Patienten liegt. Um dem Trinkdruck der Gesellschaft besser standzuhalten, empfehlen wir den regelmäßigen Besuch einer Selbsthilfegruppe wie z. B. Anonyme Alkoholiker.
Medikamentöse Entzugsbehandlung:
Die Patienten zeigen im Entzug einen dreidimensionalen, grobschlägigen Tremor, starkes Schwitzen und eine massive Kreislaufinstabilität mit Blutdruck- und Herzfrequenzschwankungen. In dieser Phase ist die Gefahr eines Delirium Tremens groß. Zu Beginn zeigen Typ I Patienten oft sehr hohe Alkoholspiegel (über 3 Promille). Ohne Therapie treten in etwa 20% der Fälle Grand Mal Anfälle auf. Die Entzugstherapie muss mit Benzodiazepinen durchgeführt werden (gute Sedierung und hohe antiepileptische Potenz). Wichtig ist, dass die Behandlung früh genug begonnen wird und dass hoch genug dosiert wird. Die Dosierung richtet sich nach dem Schweregrad der Alkoholisierung, nach dem Schweregrad der Lebererkrankung und nach der Trinkmenge, die der Patient früher benötigt hat, um mit seinem morgendlichen Entzugssyndrom fertig zu werden. Wenn der Patient zur Abstinenz nicht motiviert ist, verwenden wir heute das sogenannte „Cut Down Drinking“. Es wird ein Trinkprotokoll geführt und der Patient regelmäßig bestellt. Je nach Entwicklung des Trinkverhaltens gehen wir dann die weiteren Schritte bis zur Abstinenz.19
Medikamentöse Rückfallsprophylaxe (siehe auch Tab. 1)
| Entzugsbehandlung | Rückfallprophylaxe | |
|---|---|---|
| Typ I | Benzodiazepine | Acamprosat, Disulfiram oder Cyanamid cave: D1-Antagonisten, nur im Rückfall Naltrexon |
| Typ II | Tiaprid, Trazodon, Doxepin cave: Benzodiazepine, GHB | Acamprosat, Moclobemid cave: Benzodiazepine, GHB |
| Typ III | GHB | Naltrexon, Antidepressiva (z. B. Milnacipran, Trazodon, Doxepin, Mirtazapin), Carbamazepin, Topiramat, Valporinsäure, GHB nur im Rückfall |
| Typ IV | GHB und Carbamazepine | Naltrexon, Nootropika, GHB (als Substitution), atypische Neuroleptika (z. B. Olanzapin) |
Das in dieser Gruppe typische, eher biologisch bedingte Alkoholverlangen kann am besten mit Acamprosat behandelt werden.20
Auch bei Rückfällen sollte Acamprosat weiter eingenommen werden. Wenn es sich um Patienten handelt, die häufig hohem Trinkdruck ausgesetzt sind, kann auch eine Aversivbehandlung mit Disulfiram empfohlen werden.
Disulfiram erzeugt bekanntlich eine Alkoholunverträglichkeit. Wenn Patienten bewusst dieses Medikament einnehmen, kommt es erst gar nicht zum ersten Schluck, der dann die Alkoholgier erneut auslösen oder verstärken würde. In einer Schweizer Studie konnte gezeigt werden, dass die besten Ergebnisse durch eine Kombination von Acamprosat mit Disulfiram erzielt werden.21
5b Typ II-Diagnose, Motivation, Therapie (Angstmodell, Alkohol als Konfliktlöser bei selbstunsicherer Persönlichkeit)
Alkoholabhängige von diesem Typ nehmen Alkohol zur Angst- und Konfliktlösung zu sich. Ohne Alkohol sind diese Patienten „überangepasst“, eher passiv (depressiv-abhängige Persönlichkeitsstruktur) und haben signifikant häufiger einen dominanten Partner.22 Von Zeit zu Zeit versuchen Typ II-Patienten mit Hilfe von Alkohol aus dieser sozialen Rolle auszusteigen, wobei unter Alkoholeinfluss oft auch aggressive Durchbrüche, vor allem innerhalb der Familie, zu beobachten sind. Zu Grunde liegt eine Entwicklungsstörung, Alkohol kann nur als Epiphänomen gesehen werden. Die Patienten entwickeln nur leichte Entzugserscheinungen und haben nie epileptische Anfälle. Es besteht keine Komorbidität mit affektiven Erkrankungen.
Biologische Korrelate
Auf Grund der Angst-Aggressionssymptomatik werden in dieser Patientengruppe serotonerge Funktionsstörungen generell für wichtig gehalten.23 Unsere Forschungsgruppe konnte gemeinsam mit Berliner Kollegen nachweisen, dass auch in der Abstinenz bei Typ II-Alkoholabhängigen im endogenen Alkoholstoffwechsel erhöhte Werte von Beta-Carbolinen (entstehen durch eine Verbindung von Aldehyden mit Indolaminen) gemessen werden können, wobei jedoch in diesen Studien der Nikotinkonsum noch nicht ausreichend berücksichtigt wurde (Angstmodell, Alkohol als Konfliktlöser).24
Tabak rauchende Patienten dieser Gruppe zeichnen im Fagerström Fragebogen signifikant häufig negativ (d. h. < 5).25 Deshalb kann in dieser Gruppe Alkohol und Tabak gleichzeitig entzogen werden.
Die Aufklärung über diese Mechanismen ist zwar für die Motivation wichtig, aber nicht ausreichend. Man folgt in der Motivation den Mechanismen und Vorschlägen von Prohaska und DiClemente.26 Bei diesen Patienten steht das Persönlichkeitsproblem im Vordergrund, die Motivation zur Psychotherapie ist wichtiger als die Motivation zur lebenslangen Abstinenz. Im Verlauf der Psychotherapie sind oft Rückfälle ohne Kontrollverlust (Slips) zu beobachten. Diese benötigen keine spezifische Therapie. Im Vordergrund steht die Hebung des Selbstwertgefühles. Die Patienten müssen lernen, nur dann Ja zu sagen, wenn sie wirklich wollen, und nicht dann Ja zu sagen, weil ein Nein vielleicht Schwierigkeiten in der Partnerschaft, am Arbeitsplatz oder im sozialen Umfeld verursacht. Sie leiden oft unter sehr starken Gefühlen, denen sie aber oft nicht trauen. Und sie verwenden Alkohol oft, um diese Gefühle nicht so stark zu spüren.
Alkoholselbsthilfegruppen sind für diese Untergruppe nicht zielführend. Es sollte eher versucht werden, sie in Gruppen zu bringen, die sich mit Selbstwert und Angst beschäftigen.
Entzugstherapie des Typs II
Die Patienten zeigen einen zweidimensionalen, feinschlägigen Anspannungstremor, bieten oft leichtes Schwitzen bei stabil-angespanntem Kreislauf (Blutdruck- und Herzfrequenz erhöht). Keine epileptischen Anfälle in der Vorgeschichte.
Bereits während des Entzugs soll die psychotherapeutische Behandlung eingeleitet werden. Die Medikation ist gegenüber den psychotherapeutischen Bedürfnissen sekundär. (Ev. Ergänzung: Schwerpunktsetzung der Psychotherapie; Weckung von Eigeninitiativen, Verantwortung, „trockene“ Resozialisierung? etc.)
Medikamentöse Rückfallsprophylaxe
Monoaminoxidase-A-Hemmer haben sich klinisch als wirksame Substanzen zur Reduktion der Basisstörung (Angststörung) in diesem Typ bewährt. Dies wurde bisher aber noch nicht im Rahmen einer kontrollierten Studie überprüft. Acamprosat reduziert in dieser Gruppe signifikant die Rückfallsraten.27 Die Psychotherapie ist von primärer Bedeutung, die Medikation alleine ist meist nicht ausreichend.
Beruhigungsmittel führen bei diesen Patienten häufig zur Suchtverschiebung und sollten deshalb vermieden werden. Wenn Patienten über Einschlafstörungen oder Unruhezustände klagen, sind manchmal Schlaf anstoßende Antidepressiva zielführend.
5c Typ III: Diagnose – Motivation – Therapie (Depressionsmodell, Alkohol als Antidepressivum)
In den Familien dieser Patienten finden sich häufig affektive Erkrankungen. Diese Patienten berichten oft schon Antriebs-, Befindlichkeits- und auch Schlafstörungen lange vor Beginn des Alkoholmissbrauchs (oft bipolare Verläufe). Häufig ist ein episodisches Trinkverhalten (z. B. im Sommer kein wesentliches Alkoholproblem, von November bis Februar große Alkoholprobleme) zu erheben. Bei manchen Patienten findet man zwar keine Symptomatik, die die Diagnose einer affektiven Erkrankung rechtfertigt, aber es findet sich eine schwere suizidale Gefährdung oder auch ein Suizidversuch unabhängig von einer Alkoholeinnahme oder von einem Alkoholentzug. Alkohol wird als Antidepressivum konsumiert. Klinisch imponieren diese Patienten sehr leistungsorientiert und sehr starr strukturiert. Alkohol wird in den Familien dieser Patienten signifikant häufiger auch von anderen Familienmitgliedern als „Selbstmedikation“ benützt. Diese Situation führt meist auch zu großen sozialen Problemen in der Familie.28 Alkohol selbst verstärkt aber die Symptomatik und verschlechtert z. B. den Schlafrhythmus.
Wenn Alkoholabhängige dieser Gruppe einige Zeit abstinent sind, verbessert sich fast immer auch die chronobiologische Störung.29 Nachdem diese Basisstörungen jedoch typischerweise phasenhaft auftreten, kommt es ohne pharmakologische Hilfe in dieser Zeit zu Rückfällen (episodischer Verlauf).
Da diese Patienten sehr leistungsorientiert sind und ihre Gefühle nicht zulassen können, kommt es zu großen inneren Spannungen, die dann auch wie bei einem Überdruckventil zu einer Alkoholeinnahme führen. Unter Alkohol verlieren sie häufig ihre komplette Fassade und benehmen sich häufig sehr triebbetont. In der Therapie darf man diesen Patienten nicht zu früh Lösungen anbieten. Sie folgen einige Monate problemlos, aber ohne Veränderung ihrer Persönlichkeitsstruktur sind sie Rückfällen hilflos ausgeliefert und können diese in keiner Weise wesentlich steuern. Erst oft nach Monaten langer, regelmäßiger Therapie, in der man als Therapeut sehr zurückhaltend sein sollte, kommt es zur psychotherapeutischen Motivation. Es entwickeln sich meist starke Übertragungsmechanismen („Ich steige zu Ihnen ins Boot und begleite Sie“). Erst in dieser Therapiesituation können die Patienten Gefühle preisgeben. Jede Veränderung der Therapie (stationär zu ambulant, usw.) ist zu vermeiden. Ein klares therapeutisches Setting je nach Therapieschule ist unbedingt schon zu Beginn zu vereinbaren (z. B. Abwesenheiten des Therapeuten). Selbsthilfegruppen, die auf die Persönlichkeiten ausgerichtet sind, aber nicht auf den Alkohol, sind zielführend. Diese Patienten rauchen oft Fagerström positiv und benötigen zu Beginn der Therapie den antidepressiven Effekt der Rauchinhaltsstoffe, weshalb nach einer guten antidepressiven Einstellung und nach einigen Monaten Abstinenz auch die Tabakabhängigkeit behandelt werden sollte.
Biologische Korrelate
Biochemisch werden alle Mechanismen diskutiert, die auch bei manisch-depressiver Erkrankung Beachtung finden.30
Entzugstherapie
So wie Typ II-Patienten, zeigen diese Patienten einen zweidimensionalen feinschlägigen Tremor, leichtes Schwitzen und einen stabilen, angespannten Kreislauf (Blutdruck- und Herzfrequenz erhöht). Epileptische Entzugsanfälle sind selten. Diese Patienten sind im Entzug ängstlich-depressiv. Diese Entzugserscheinungen können mit einer sorgsam gewählten Medikation behandelt werden wie Gammahydroxybuttersäure, Doxepin oder mit Antikonvulsiva.31
Medikamentöse Rückfallsprophylaxe (siehe Tab. 1)
Diese stützt sich vornehmlich auf Antidepressiva und Naltrexon.
5d Typ IV: Diagnose – Motivation – Therapie
(Gewöhnungsmodell, vor-alkoholische cerebrale Schäden und kindliche Entwicklungsstörung, zyklothymes Temperament bis zur Borderline Persönlichkeitsstörung)
Vor Beginn der Trinkkarriere bestehen bereits deutliche Auffälligkeiten: zerebrale Vorschäden (vor dem 14. Lebensjahr); sehr schwierige familiäre Verhältnisse führen zu kindlichen Verhaltens-auffälligkeiten (wie z. B. längerfristiges Stottern, Nägelbeißen und/oder nächtliches Einnässen nach dem 3. Lebensjahr).32 Zwanghafte Verhaltensweisen und eine Kritiklosigkeit dem Alkoholkonsum gegenüber bewirken, sodass dem Trinkdruck der Gesellschaft oder dem aktuellen „Trinkdruck“ der jeweiligen Situation zu wenig Widerstand geleistet werden kann, so dass ein längerfristiger Missbrauch entsteht und chronifiziert, der schon bald zu schweren Leistungsreduktionen und/oder somatischen Störungen führt. Epileptische Anfälle außerhalb des Entzuges und oft schon vor Beginn des Alkholmissbrauches weisen auf die zerebrale Vorschädigung hin. Die Alkoholabhängigkeit wird in dieser Patientengruppe als zusätzlicher, komplizierender Faktor der schweren psychischen und psychosozialen Schädigung gesehen. Verbesserung der Impulskontrolle und Verbesserung der Leistungsfähigkeit sind das Ziel der Therapie, wobei Selbsthilfegruppen, die auch Rückfälle akzeptieren, hilfreich sind. Häufige Rückfälle auch nach stationären Therapien prägen den Verlauf dieser Untergruppe. Gerade in dieser Gruppe wird in der Gesellschaft oft die Selbstverschuldung diskutiert. Doch gerade diese Patienten sind dem Trinkdruck der Gesellschaft hilflos ausgeliefert. In Wirklichkeit haben sie schon seit ihrer Zeugung wenige Chancen und erhalten in der Kindheit nicht die Hilfen von der Gesellschaft, die diese schlechte Entwicklung vermeiden könnte. Wenn sie dann nach vielen Jahren in Behandlung kommen, sind sie kognitiv oft so stark beeinträchtigt, dass das therapeutische Ziel nur mehr die Lebensqualität und eine Verlängerung des Lebens ist. Abstinenz wäre natürlich das Ziel, ist aber realistisch oft nicht erreichbar, obwohl diese Patienten häufig hoch motiviert sind und viele stationäre Aufnahmen und Entwöhnungsbehandlungen haben. Wir konnten in einem Pilotversuch zeigen, dass Typ IV-Patienten mit Maßnahmen, die dem Patienten eine soziale Sicherheit geben und mit Gruppenbildungen, die wie Ersatzfamilien funktionieren, sehr wohl auch lange abstinente Perioden haben können. Bei schweren Rückfällen sind ein Krisenkonzept und manchmal kurzfristige Aufnahmen notwendig. Eine suggestive Sprache, die mit kurzen einfachen Sätzen arbeitet, ist zielführend. Schwierige psychotherapeutische Vorschläge werden vom Patienten nicht verstanden und können deshalb von ihnen auch nicht befolgt werden.
Biologische Korrelate
Schwere Polyneuropathien sind ausschließlich im Typ IV vorhanden (siehe Entscheidungsbaum). Alle Mechanismen, die ursächlich mit kognitiven Leistungsveränderungen, mit Gedächtnisfunktionen oder mit Mechanismen der Impulskontrolle diskutiert werden, spielen eine Rolle (Gewöhnungsmodell, vor-alkoholische cerebrale Schäden).
Tabak rauchende Patienten dieser Gruppe zeichnen im Fagerström Fragebogen signifikant häufig positiv (d. h. ≥ 5).33
Medikamentöse Entzugstherapie
Der Entzug ist charakterisiert durch nur leichten Tremor (gemischter Typ, oft cerebellär), stabilen Kreislauf, fast kein Schwitzen.34 In der intellektuellen Leistung und in allen Gedächtnisfunktionen sind die Patienten deutlich beeinträchtigt (Durchgangssyndrome).35 Für die Therapie eignen sich Nootropika, Antiepileptika, biologisch aktives Licht und Gammahydroxybuttersäure (GHB).36
Medikamentöse Rückfallsprophylaxe (siehe Tab. 1)
basiert auf Nootropika, Thiamin, Carbamazepin, Antidepressiva und in seltenen Fällen auch atypischen Neuroleptika.37
Die medikamentöse Therapie nach der Typologie in der Zusammenfassung (Tab. 1)
Nach diesem Schema ist klar zu erkennen, dass ohne typologische Zuordnung auch keine rationale medikamentöse Entzugsbehandlung und medikamentöse Rückfallprophylaxe möglich ist. Falsche Behandlungen führen natürlich häufig zu Rückfällen, die dann auch noch der fehlenden Motivation des Patienten zugeordnet werden. Bei der richtigen Wahl des Therapiezieles und bei einer typenspezifischen Therapie ist es sehr selten, dass Patienten nicht zu einer Lebensstiländerung motiviert werden können.38
Conclusio
Abhängigkeitserkrankungen werden heute weltweit als Erkrankungen akzeptiert. Alle neueren Befunde belegen diese Tatsache (genetisch, Basis-Forschung, Verlauf und Therapie).
Die Heterogenität dieser Erkrankung und die heute verwendeten Typologien sind sehr gut belegt. Typ IV und Typ III zeigen oft einen sehr autonomen Verlauf, der weder vom Patienten noch vom Therapeuten mit einfachen Abstinenzansätzen verändert werden kann. Die häufigen Rückfälle in diesen Verläufen müssen oft vom Therapeuten und vom Patienten akzeptiert werden.
Im Typ I ist der Patient in den Trinkphasen aufgrund seiner schweren Entzugssymptomatik nur mit der richtigen Medikation zur Abstinenz zu motivieren. Ohne Medikation ist es ihm oft nicht möglich, auf Alkohol zu verzichten. Ist er einige Wochen abstinent, kann er das neuerliche Trinken jedoch sehr wohl eigenverantwortlich steuern.
Nach einer entsprechenden Beratung kann der Typ I die Gefährlichkeit des ersten Schlucks sehr wohl beurteilen.
Der Typ II ist aus Sicht der Abhängigkeit die leichteste Form, aber er leidet oft an einem fast fehlenden Selbstwertgefühl und aufgrund dieses unsicheren Ichs ist er den Umwelteinflüssen einer trinkenden Gesellschaft oft wehrlos ausgeliefert.
In der Therapie werden diese Personen aber dann oft so selbstsicher, dass sie kein Suchtmittel mehr brauchen, um ihre Gefühle zu leben.
Die Verantwortlichkeit ergibt sich aufgrund der Typologie, aber natürlich spielen dafür auch viele andere Faktoren eine große Rolle (Biographie, Lebenssituation, intellektuelle Ausstattung, Zukunftsaussichten usw.)
In Bezug zu anderen nicht stoffgebundenen Suchtformen ist nur zu sagen, dass bei Essstörungen ähnliche Überlegungen bestehen, alle anderen Verhaltensauffälligkeiten aber weder genügend Basis noch klinische Daten haben, um irgendeine Stellungnahme zu ermöglichen. Im ICD 11 sollen diese Verhaltensauffälligkeiten als Impulskontrollstörungen in einer eigenen Kategorie zusammengefasst werden, um sie besser beforschen zu können.
Referenzen
- Uexküll T., Die Kommunikation über die Diagnose, in: Adler R. H. et al., Psycho-somatische Medizin, 5. Auflage, Urban & Schwarzenberg, Wien (1996), S. 1225-1229
- Leggio L. et al., Swift Typologies of Alcohol Dependence, From Jellinek to Genetics and Beyond, Neuropsychol Rev (2009);19: 115-129
Hesselbrock V. M., Hesselbrock M. N., Are there empirically supported and clinically useful subtypes of alcohol dependence?, Addiction (2006); 97-103
Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., Alkohol und Tabak Medizinische und Soziologische Aspekte von Gebrauch, Missbrauch und Abhängigkeit, Springer Verlag, Wien (2006) - Dilling H., Mombour W., Schmidt M. H., Internationale Klassifikation psychischer Störungen, World Health Organisation, Verlag Hans Huber, Bern, Göttingen, Toronto (1991)
American Psychiatric Association, DSM IV. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fourth Edition (1994) - Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., siehe Ref. 2
- Dilling H., Mombour W., Schmidt M. H., siehe Ref. 3
American Psychiatric Association, siehe Ref. 3 - Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., siehe Ref. 2
- Johnson B. A., Ruiz P., Galanter M., Handbook of Clinical Alcoholism Treatment, Williams & Wilkins, Lippincott (2003)
- Dilling H., Mombour W., Schmidt M. H., siehe Ref. 3
- Johnson B. A., Ruiz P., Galanter M., siehe Ref. 7
- Hermann P., Vortrag im Rahmen des Alpe Adria Symposiums 2009 in Senigallia, Italien
- Jellinek E. M., The disease concept of alcoholism, Hillhouse, New Brunswick RI (1960)
- Cloninger C. R. et al., Genetic heterogeneity and the classification of alcoholism, Adv Alcohol Subst Abuse (1988); 7(3-4): 3-16
Babor T. F., Meyer R. E., Typologies of Alcoholics: Overview, in: Galanter M. (Ed.), Recent Developments in Alcoholism, Plenum Publishing Corp, New York, NY (1986), S. 105-111
Lesch O. M., Bonte W., Grünberger J., Eine Typologie des chronischen Alkoholismus – Neue Basisdaten für Forschung und Therapie, in: Ladewig D. (Hrsg.), Drogen und Alkohol, ISPA Press, Lausanne (1988), S. 119-134
Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., siehe Ref. 2 - Leggio L. et al., siehe Ref. 2
Hesselbrock V. M., Hesselbrock M. N., siehe Ref. 2 - Johnson B. A., Ruiz P., Galanter M., siehe Ref. 7
- Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., siehe Ref. 2
- Sprung R., Bonte W., Lesch O. M., Methanol. Ein bisher verkannter Bestandteil aller alkoholischer Getränke; Eine neue biochemische Annäherung an das Problem des chronischen Alkoholismus, Wien Klin Woschr (1988) 100: 282-288
- Bleich S. et al., Moderate alcohol consumption in social drinkers raises plasma homocystein levels: a contradiction to the „french paradox“, Alcohol Alcohol (2001); 36: 189-192
- Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., siehe Ref. 2
Hertling I. et al., Behandlung der chronischen Alkoholabhängigkeit. Gibt es Untergruppen für Psychotherapie mit Hypnose, Hypnose (2002); 19: 107-116 - Sinclair J. D., Evidence about the use of naltrexone and for different ways of using it in the treatment of alcoholism, Alcohol (2001); 36: 2-10
Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., siehe Ref. 2 - Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., siehe Ref. 2
Lesch O. M., Walter H., Subtypes of Alcoholism and their Role in Therapy, Alcohol Alcohol (1996); 31: 63-67
Kiefer F. et al., Pharmacological relapse prevention of alcoholism: clinical predictors of outcome, Eur Addict Res (2005); 11: 83-91
Lesch O. M. et al., The European Acamprosate Trials: Conclusions for Research and Therapy, J Biomed Sci (2001); 8: 89-95 - Besson J. et al., Comined efficacy of acamprosate and Disulfiram in the treatment of alcoholism: a controlled study, Alcohol Clin Exp Res (1998); 22: 573-579
- Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., siehe Ref. 2
- Heinz A. et al., Serotonergic dysfunction, negative mood states, and response to alcohol, Clin Exp Res (2001); 25: 487-495
- Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., siehe Ref. 2
- Hertling I. et al., siehe Ref. 18
- Prochaska J., DiClemente C., Stages of changes in modification of problem behaviours, in: Hersen M., Eisler R., Miller P. (Eds.), Progress in behaviour modification, Sage Publications, Newbury Park, CA (1992), S. 84-218
- Lesch O. M., Walter H., siehe Ref. 20
Kiefer F. et al., siehe Ref. 20
Lesch O. M. et al., siehe Ref. 20
Withworth A. B. et al., Comparison of acamprosate and placebo in long-term treatment of alcohol dependence, Lancet (1996); 347: 1438-1442 - Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., siehe Ref. 2
- Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., siehe Ref. 2
Dvorak A. et al., Alcohol dependence and depressive Syndromes, Int Clin Psychopharmacol (2003) ; 18: 47-53 - Dvorak A. et al., siehe Ref. 29
Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., siehe Ref. 2 - Nimmerrichter A. et al., Double-blind controlled trial of GHB and clomethiazole in the treatment of alcohol withdrawal, Alcohol Alcohol (2002); 37: 67-73
Walter H. et al., Sensitivity and specificity of carbohydrate-deficient transferrin in drinking experiments and different patients, Alcohol (2001); 25: 189-194 - Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., siehe Ref. 2
- Hertling I. et al., siehe Ref. 18
- Hopf H. C., Poeck K., Schliak H., Neurologie in Praxis und Klinik, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York (1983)
- Lesch O. M., Psychische Störungen durch internistische Leiden, in: Faust V. (Hrsg.), Psychiatrie – Ein Lehrbuch für Klinik, Praxis und Beratung, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York (1995), S. 553-559
Berner P., Psychiatrische Systematik, Huber, Bern, Stuttgart, Wien (1986) - Nimmerrichter A. et al., siehe Ref. 31
- Johnson B. A., Ruiz P., Galanter M., siehe Ref. 7
Johnson B. A. et al., Oral topirament of alcohol dependence: a randomised controlled trial, Lancet (2003); 361: 1677-1685 - Lesch O. M., Walter H., Wetschka C., siehe Ref. 2
Weiterführende Literatur
- Lesch O. M., Die Diagnose Abhängigkeit, Fortschr Neurol Psychiat (2009); 77: 1-6
- Lesch O. M. et al., Diagnosis of Chronic Alcoholism – Classificatory Problems, Psychopathology (1990); 23(2): 88-96
- Wiesbeck G. et al., Flupenthixol Decanoate and Relapse Prevention in Alcoholics: Results from a Placebo-Controlled Study, Alcohol & Alcoholism (2001); 36: 329-334
- Walter H. et al., Dopamine and Alcohol Relapse: D1 and D2 Antagonists Increase Relapse Rates in Animal Studies and in Clinical Trials, J Biomed Sci (2001); 8: 83-88
- Hertling I. et al., Entzugsbehandlung von alkoholabhängigen Patienten, Wien Zschr Suchtforschung (2001); 24: 41-46
- Wiesbeck G., et al., Flupenthixol Decanoate and Relapse Prevention in Alcoholics: Results from a Placebo-Controlled Study, Alcohol Alcohol (2001); 36: 329-334
- Johnson B. A., Ait-Daoud N., Neuropharmacological treatments for alcoholism: scientific basis and clinical finingsm, Psychopharmacology (2000); 149: 344
- Pettinati H. M., Kranzler H. R., Maderas J., The status of serotonin-selective pharmacotherapy in the treatment of alcohol dependence. Recent developments in alcoholism: An official publication of the American Medical Society On Alcoholism, Research Society On Alcoholism and National Council On Alcoholism (2003); 16: 247-262
- Kranzler, persönliche Mitteilung
- Sinclair J. D., Evidence about the use of naltrexone and for different ways of using in the treatment of alcoholism, Alcohol Alcohol (2001); 36: 2-10
- Chick J. et al., A multicentre, randomized, double-blind, placebo controlled trial of naltrexone in the treatment of alcohol dependence or abuse, Alcohol Alcohol (2000); 35: 587-593
- Lesch O. M., Soyka M., Typologien der Alkoholabhängigkeit und ihre Bedeutung für die medikamentöse Therapie, in: Riederer P., Laux G., Neuro-Psychopharmaka, Band 6, 2. Auflage, Springer Verlag, Berlin (2005), S. 332-348
- Lesch O. M. et al., Die medikamentöse Therapie von Missbrauch und Abhängigkeiten (Tabak, Alkohol und illegale Drogen), in: Riederer P., Laux G., Neuro-Psychopharmaka, Springer Verlag, Berlin (2009) (in Druck)
Univ.-Prof. Dr. Otto Lesch
Univ. Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Währinger Gürtel 18-20, A-1090 Wien
Otto.Lesch(at)meduniwien.ac.at