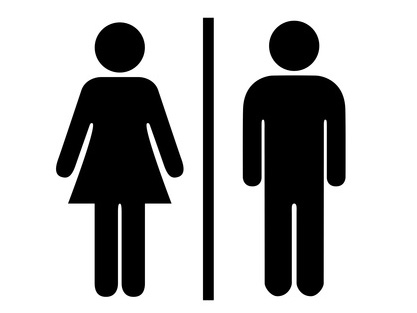Der rasante Anstieg von Kindern und Jugendlichen, die Probleme mit ihrer Geschlechtsidentität haben, birgt viele offene Fragen. Allein in Großbritannien stieg die Zahl der Minderjährigen, die sich zwischen 2009 und 2017 einer Transgender-Behandlung unterzogen, von 97 auf 2.519 Fälle, was einer 25-fachen Steigerung gleichkommt. Innerhalb der Gruppe stieg der Anteil der Mädchen mit Geschlechtsdysphorie (GD) gar um 4.500 Prozent. Die britische Ministerin für Frauen und Gleichberechtigung, Penny Mordaunt, möchte nun die Ursachen für diese extreme Zunahme untersuchen lassen (vgl. The Telegraph, online, 16.9.2018). Auch in den USA waren unter den GD-betroffenen Teenagern 2009 noch weniger als die Hälfte weiblich (41 Prozent). Bis 2017 stieg diese Zahl auf fast 70 Prozent (vgl. The Economist, online, 1.9.2018).
Das Gefühl, im falschen Körper zu sein, bedeutet nicht zwingend auch eine Geschlechtsdysphorie (GD) oder Geschlechtsidentitätsstörungen (GIS), wie zwei aktuelle Studien nahelegen. So waren in Großbritannien bei rund 35 Prozent der an die Londoner Tavistock Clinic überwiesenen Jugendlichen mäßige bis schwer autistische Merkmale festzustellen, berichtet Co-Autorin Bernadette Wren, die seit 25 Jahren an dieser auf Transgender-Kinder spezialisierten Klinik arbeitet und die Abteilung der Klinischen Psychologie leitet. Psychotherapeuten warnen davor, dass Kinder falsch behandelt werden. Die britischen, im Archives of Disease in Childhood publizierten britischen Zahlen (2018; 103(7): 631-636) legen nahe, dass 150 Kinder und Jugendliche fälschlich als Transgender diagnostiziert und dann unnötigen Hormontherapien mit starken Nebenwirkungen unterzogen worden sind, mit teils irreversiblen Folgen (vgl. Daily Mail, online, 22.7.2018).
Immer häufiger tritt auch das Phänomen auf, dass Jugendliche, die in der Vergangenheit keine geschlechtsspezifische Störung hatten, plötzlich mitteilten, transgender zu sein. Eine in PLOS publizierte Studie (August 16, 2018 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202330) setzt diese sog. Rapid Onset Gender Dysphoria mit Gruppendruck und einer verstärkter Nutzung von sozialen Medien und einschlägigen Webseiten in Zusammenhang. Studienleiterin Lisa Littmann vom Institut für Verhaltens- und Sozialwissenschaften der Brown University School of Public Health vermutet eine Form von „sozialer Ansteckung“.
In den von Minderjährigen, die plötzlich eine GIS und GD zeigten, frequentierten Social-Media-Gruppen war es zu einem regelrechten Cluster-Outbreak gekommen. Bei der GD könnte es sich laut Littmann um eine Coping-Strategie handeln, ähnlich wie eine Anorexie oder nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten, hinter denen andere psychische Probleme stehen. Die Medizinerin hält fest, dass bei 62,5 Prozent der betroffenen Jugendlichen eine oder mehrere psychiatrische Störungen diagnostiziert wurden, bevor sie ankündigten, dass sie trans waren. 48,4 Prozent hatten eine Stress- oder Traumaerfahrung. 45 Prozent zeigten selbstverletzendes Verhalten und 58 Prozent wiesen Schwierigkeiten in der Gefühlsregulation auf.
Littmanns Studie stieß auf starken Widerspruch, ihr wurde „Transphobie“ vorgeworfen. Der australische Psychiater Roberto D'Angelo hingegen hält Littmanns Ansatz für wichtig (vgl. Pediatric and Adolescent Gender Dysphoria Working Group, 2018). Es sei notwendig, eine Patientengruppe klar zu identifizieren, um sowohl vor Über- als auch Unterdiagnosen zu schützen. Auch der deutsche Kinder- und Jugendpsychiater Alexander Korte von der Universität München mahnte kürzlich am Kongress für Kinder- und Jugendmedizin in Leipzig (vgl. SpringerMedizin, online, 22.9.2018) zu größerer diagnostischer Umsicht. Geschlechtsinkongruenz und GD würden heute zunehmend als Sinnangebote funktionieren: Sie würden Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihrem individuellen Leiden in einer zu ihrer Zeit passenden und in ihrer Kultur akzeptierten Form Ausdruck zu verleihen. „Sie verheißen gleichzeitig Aufmerksamkeit und Status des Besonderen“, so Korte.
Die klinische Psychologin Bernadette Wren hatte bereits Anfang 2018 vor einem zunehmenden Druck auf Kinder gewarnt, psychische Probleme scheinbar zu lösen, indem sie ihr Geschlecht ändern (vgl. Bioethik aktuell, 12.2.2018). Die nun vom britischen Ministerium in Auftrag gegebene Studie soll u. a. klären, welche Rolle soziale Medien und Schulen für die Ausweitung der Transgender-Problematik bei Kindern spielen.