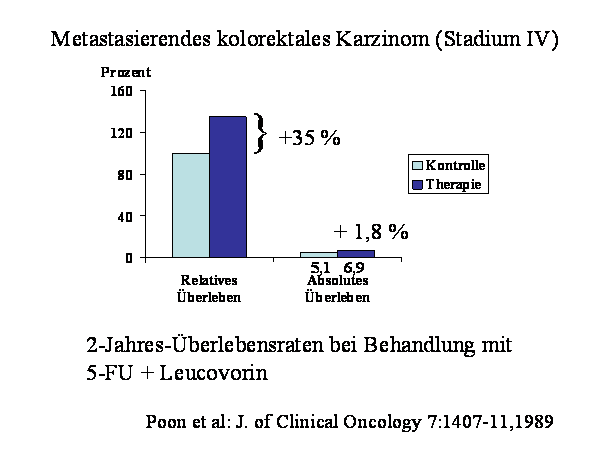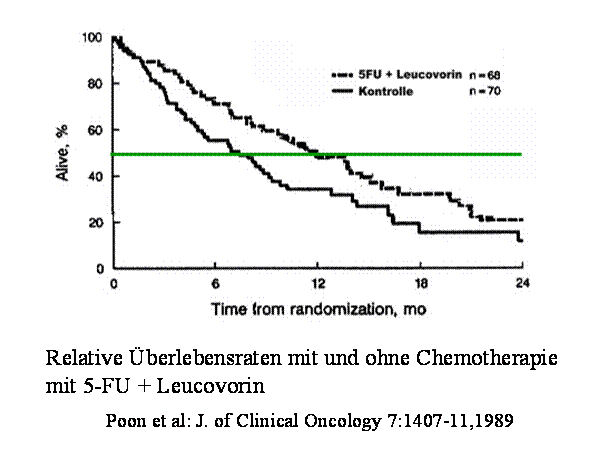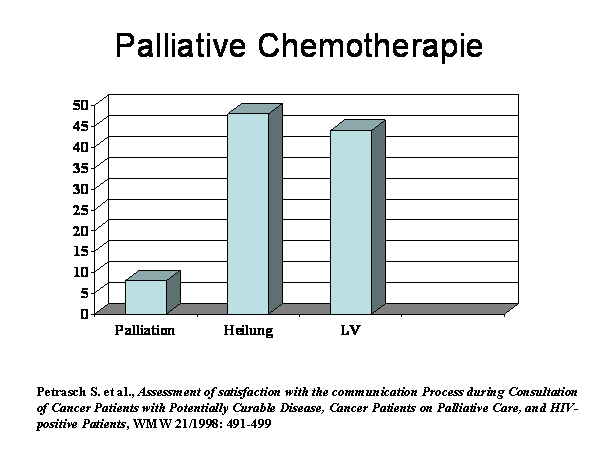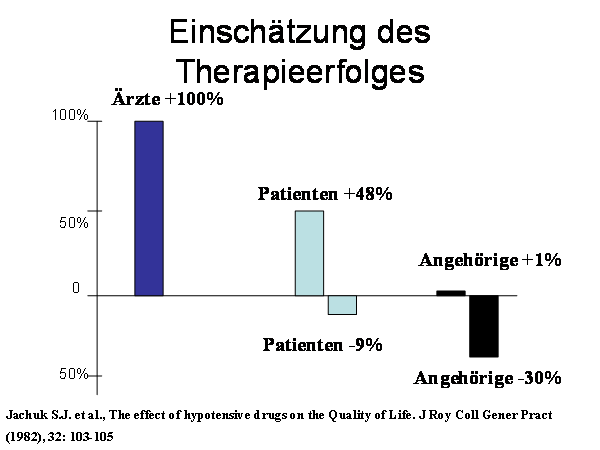Karzinomtherapie zwischen Individualität und Evidence Based Medicine aus der Perspektive der sinnorientierten Medizin (S.O.M.)
Einleitung
Wenngleich nicht geleugnet werden kann, dass in den letzten Jahrzehnten – auch in der Onkologie – große Fortschritte erzielt worden sind, so hat dieser Fortschritt zum Teil Hoffnungen geschürt – meist gestützt durch voreilige Medien-Propaganda –, die manchmal ziemlich weit an der Realität vorbeigehen und oft dazu führt, dass alles was machbar ist, automatisch durchgeführt wird, ohne sich genau zu fragen, ob diese Maßnahmen sinnvoll sind, d. h. ob dem Patienten damit auch wirklich noch geholfen wird!
So wurde 2001 bei der Jahrestagung der Amerikanischen Gesellschaft für Onkologie in San Francisco eine Studie1 vorgestellt, aus der hervorgeht, dass rund ein Drittel aller Krebspatienten im Endstadium noch eine Chemotherapie bekommen und zwar bei Tumoren, bei denen erwiesen ist, dass die Behandlung unwirksam ist. Weiters wurde festgestellt, dass bis heute noch keine Richtlinien existieren, bis wann eine Chemotherapie noch sinnvoller Weise einzusetzen ist.
Und hier scheint die Herausforderung in der Onkologie heute zu liegen. Nämlich die trügerischen Klippen einer überzogenen kurativen Medizin rechtzeitig zu erkennen, um sich dann ganz auf eine symptomorientierte Leidenslinderung, also auf die Palliativmedizin, zu verlegen.
Surrogatparameter
Eine dieser Klippen ist die trügerische Behandlung von Surrogatparametern (Ersatzkriterien der Wirksamkeit einer Therapie) gerade auch in der Onkologie. In gar nicht so wenigen Fällen kann z. B. in Studien eine Tumorverkleinerung durch eine Chemotherapie nachgewiesen werden, was aber noch lange nicht bedeutet, dass dadurch eine der drei maßgeblichen Zielparameter ärztlichen Handelns, nämlich Heilung, Lebensverlängerung oder zumindest Leidensminderung, nennenswert beeinflusst würden. Hier klaffen oft Machbarkeit und Sinnhaftigkeit weit auseinander. Tumoren werden zwar erfolgreich behandelt, ohne dass dies allerdings dem Patienten irgendwie nützt – im Gegenteil, die Komplikations- und Nebenwirkungsraten solcher Behandlungen sind oft erheblich. Beispiele wären das fortgeschrittene Magenkarzinom, das nicht-kleinzellige Bronchuskarzinom, die Applikation von Zytostatika in die Arteria Hepatica bei Lebermetastasen oder die Chemotherapie beim nicht operablen Gallenblasen- bzw. Gallengangskarzinom.
Absolutes und relatives Risiko
Eine andere trügerische Klippe ist die oft irreführende Darstellung von Studienergebnissen. Als Beispiel sei hier das metastasierende Dickdarmkarzinom aufgeführt. Es wird behauptet, dass die Überlebensrate durch eine Chemotherapie um 35% verbessert werden kann (Abb. 1). Das klingt sicher sehr gut.
In der Tat wird daher im Standardwerk der Internistischen Onkologie von H. J. Schmoll bemerkt, dass die Chemotherapie beim fortgeschrittenen Dickdarmkarzinom „hochwirksam“ ist und daher eine „klare Berechtigung“ hat. Analysiert man jedoch diese 35% genau, so zeigt sich, dass es sich hier nur um eine Relativzahl handelt. In Wirklichkeit beträgt die Überlebensrate im Stadium IV des colorektalen Karzinoms nach 2 Jahren absolut lediglich 5,1% und kann durch eine Chemotherapie um 1,8% (das sind 35% von 5,1) reduziert werden. Es bleibt also von den 35% in Wirklichkeit nicht sehr viel übrig.
Die Moral dieser Rechnung ist, dass Therapieerfolge zwar gerne und fast immer nur in Relativzahlen angegeben werden, weil diese am meisten beeindrucken, dass sie aber in Wirklichkeit nichts über die tatsächlichen Verhältnisse aussagen.
Überlebensraten sind an sich für die Entscheidungsfindung im Einzelfall nämlich wenig hilfreich, ja eigentlich irreführend, weil das Wort „Überleben“ Heilungschance suggeriert, während in Wirklichkeit der Tod nur etwas hinausgeschoben werden kann. Was damit gemeint ist, sieht man in Abbildung 2.
Die untere Kurve zeigt die Mortalität beim fortgeschrittenen Dickdarmkrebs (Colorektalen Karzinom Stadium IV) in der Kontrollgruppe, die obere unter der heutigen Standardtherapie (5-FU + Leucoverin). Es kommt also zu einer gewissen Verschiebung der Mortalitätskurven, d. h. der Tod kann durch die Chemotherapie zwar etwas hinausgeschoben, aber natürlich letztlich nicht verhindert werden (auch nicht bei 1,8% der Fälle). Nach 3 Jahren sind praktisch alle Patienten verstorben. Von Überleben im Sinne von Heilung kann daher in diesem Stadium nicht die Rede sein. Die mediane Lebenserwartung beträgt unbehandelt 8 Monate, unter Chemotherapie 12 Monate. Im Klartext gesprochen heißt dies: man erreicht durch eine Chemotherapie eine realistische Lebensverlängerung im Durchschnitt von 4 Monaten (bestenfalls um ein ½ Jahr). Das klingt schon anders als wenn von Verbesserung der Überlebensraten um 35% und hochwirksamer Therapie gesprochen wird.
Noch viel geringer sind, wie gesagt, die Effekte z. B. beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom und trotzdem ist auch bei diesen Patienten eine Chemotherapie heute fast schon obligat, jedenfalls weit verbreitet.
Die meisten Patienten lassen so eine Behandlung angesichts des drohenden Todes ohne Widerrede trotz erheblicher Nebenwirkungen über sich ergehen, allerdings meist unter völlig falschen Voraussetzungen.
So konnten Petrasch und Mitarbeiter in einer Studie2 zeigen (Abbildung 3), dass nur 8% aller Patienten in einem fortgeschrittenen Krebsstadium realisierten, dass sie nur mehr aus palliativen Erwägungen eine Chemotherapie erhielten. 48% also fast die Hälfte hingegen dachten, dass sie durch die Behandlung noch vollständig geheilt werden könnten. Der Rest von 44% rechnete offensichtlich zumindest mit einer günstigen Beeinflussung der Grunderkrankung. Angesichts solcher Hoffnungen ist es nicht verwunderlich, dass die Patienten Nebenwirkungen wie Übelkeit, Abgeschlagenheit und Haarausfall relativ gleichmütig in Kauf nahmen, obwohl es sich ja um eine palliative Behandlung handeln sollte.
Nebenwirkungen und Komplikationen
Damit kommen wir zum eigentlichen Problem: nämlich einer vernünftigen Schaden-Nutzen-Abwägung. Bei einer Chemotherapie oder Radiobestrahlung muss praktisch in jedem Fall mit Nebenwirkungen gerechnet werden, in 20% sogar mit schweren Nebenwirkungen. Jeder potentielle Therapieerfolg muss daher abgewogen werden gegen den vorhersehbaren potentiellen Schaden, der dem Patienten zugemutet wird. Dabei scheinen Ärzte freilich ziemlich realitätsfremd zu sein. Nach einer Studie von Jachuk und Mitarbeitern3 divergieren die Eigen- und Fremdeinschätzung eines Therapieerfolges beträchtlich. Während die Ärzte bei 100% ihrer Patienten davon überzeugt waren, dass durch ihre Therapie eine Besserung des Allgemeinbefindens eingetreten ist (Abb. 4) waren die Patienten selbst davon nur in 48% überzeugt, 9% registrierten eine Verschlechterung. Die Angehörigen sahen überhaupt nur bei 1% der Patienten eine Besserung, dafür in 30% sogar eine erhebliche Verschlechterung.
Wie sehr das Nutzen/Risiko-Kalkül durch subjektive Interessen und Modetrends beeinflusst werden kann, hat auch das Debakel mit der Hormonersatztherapie gezeigt. Jahrelang hat man zweifelhafte Vorteile auf die Coronararterien, Osteoporose und Morbus Alzheimer propagiert und offensichtliche Risiken wie Schlaganfall, Lungenembolie, Thrombosen, Cholelithiasis und Mammakarzinom verharmlost, obwohl die Bilanz eindeutig negativ ist.
Zusammenfassend könnte man vielleicht sagen, dass das Schicksal unserer (onkologischen) Patienten ganz wesentlich von der Fähigkeit der Ärzte abhängt, Studienergebnisse und Therapieerfolge kritisch zu beurteilen und Schaden gegen Nutzen realistisch abzuwägen. Vor allem sollten wir in der Bevölkerung nicht Hoffnungen erwecken, die die Medizin in Wirklichkeit nicht erfüllen kann. In vielen Fällen scheint bei Patienten in einem fortgeschrittenen Krebsstadium z. B. vorsichtiges Abwarten und Beobachten im Rahmen einer symptomorientierten Palliativmedizin sinnvoller und für den Patienten hilfreicher zu sein als eine aggressive und belastende Tumortherapie mit letztlich doch eher mageren Erfolgsaussichten.4 Die Entscheidung, ob und welche medizinische Maßnahme bei einem konkreten Patienten sinnvoller Weise angewendet werden soll, kann nicht allein von statistischen Signifikanzen abhängig gemach werden, sondern sie hängt zusätzlich von einer Reihe von individuellen Faktoren ab, die mit ins Kalkül einer Entscheidung eingebracht werden müssen!
Sinnvoll ist eine Behandlung nur dann, wenn sie für den konkreten Patienten wirklich hilfreich ist, wenn also das Machbare ins Verhältnis zum praktisch vernünftigen gesetzt wird. Die Entscheidung darüber hängt einerseits von der rechten Abwägung zwischen Nutzen und Schaden (Relevanz), andererseits aber auch von individuellen Kriterien des Patienten selbst ab (z. B. Alter, Lebenserwartung, kognitive Fähigkeiten, aber auch ganz subjektive Interessen und Wertvorstellungen des Patienten). Konsenskonferenzen, Multicenterstudien, Statistiken können vielleicht, wie gesagt, über die Wirksamkeit einer Therapie, nicht aber über ihre Sinnhaftigkeit etwas aussagen. Dieses Urteil obliegt einzig und allein dem behandelnden Arzt.
Für einen Patienten, der noch eine in seinen Augen ganz wichtige Aufgabe zu erledigen hat, wird vielleicht eine kurze Zeit der Lebensverlängerung, in der er dies noch erreicht, von erheblicher Bedeutung sein. Andererseits sind Lebensverlängerung als solche und die Gesundheit überhaupt nicht immer und unter allen Umständen der höchste Wert. In gewisser Hinsicht setzen wir unser Leben bzw. die Gesundheit um einer bestimmten Sinnerfüllung willen ständig aufs Spiel.
Ärztliche Kunst besteht nun gerade darin, durch kluge Abwägung vielfältiger objektiver und subjektiver Komponenten, das für den konkreten Patienten Beste zu tun. Hier wird vom Arzt ein hohes Maß an Klugheit gefordert, die als Kardinaltugend der ärztlichen Kunst bezeichnet werden kann. Aber gerade deshalb erscheint es wichtig, nicht nur die Signifikanz einer Therapie im Sinne einer Evidence based Medicine festzustellen, sondern darüber hinaus auch andere Kriterien für deren Relevanz ins Kalkül zu ziehen. Eine ärztliche Entscheidung kann nämlich durchaus „medizinisch korrekt“, aber für den Einzelfall dennoch falsch sein!
Es scheint an der Zeit, dass die moderne Medizin wieder mehr auf die Befindlichkeit des Patienten achtet, also auf die Verbesserung seiner Lebensqualität und auch auf die Verursachung von Nebenwirkungen, anstatt sich allzu sehr auf marginale Erfolge der Lebensverlängerung zu konzentrieren. Wenn Lebensverlängerung nur noch Leidensverlängerung bewirkt, ohne dieses Leiden auch zu lindern, kann dies nicht unser ärztlicher Auftrag sein. Hilfreich ist eine Therapie vor allem dann, wenn es dem Patienten dabei auch besser geht.
Kurz gesagt: Karzinomtherapie zwischen Individualität und Evidence based Medicine (EBM) besteht in einer sinnorientierten Medizin (SOM),5 die es erlaubt, unter Einbeziehung einer Vielfalt von objektiven und subjektiven Kriterien für den Patienten eine den Umständen und Möglichkeiten angemessene Therapieentscheidung zu treffen; die also in der Lage ist, eine Brücke zu schlagen zwischen der allgemeinen normativ-statistischen Ebene und den partikulären Bedürfnissen des Patienten.
Referenzen
- San Francisco, 14. Mai 2001, Jahrestagung der amerikanischen Gesellschaft für Onkologie
- Petrasch S. et al., Assessment of satisfaction with the communication Process during Consultation of Cancer Patients with Potentially Curable Disease, Cancer Patients on Palliative Care, and HIV-positive Patients, WMW (1998); Vol. 21: 491-499
- Jachuk S.J. et al., The effect of hypotensive drugs on the Quality of Life, J Roy Coll Gener Pract (1982); Vol. 32: 103-105
- Koedoot C.G. et al., Palliative Chemotherapy or Watchful Waiting? A Vignettes Study Among Oncologists, Journal of Clinical Oncology (2002); Vol. 20, No. 17: 3658-64
- Bonelli J., Prat E., Sinnorientierte Medizin (S. O. M.). (Sense Oriented Medicine – S. O. M.) Paradigmawechsel in der Medizin: Von der Machbarkeit zur Sinnhaftigkeit – Medizin für den Einzelfall, Imago Hominis (1999); 3: 187-207