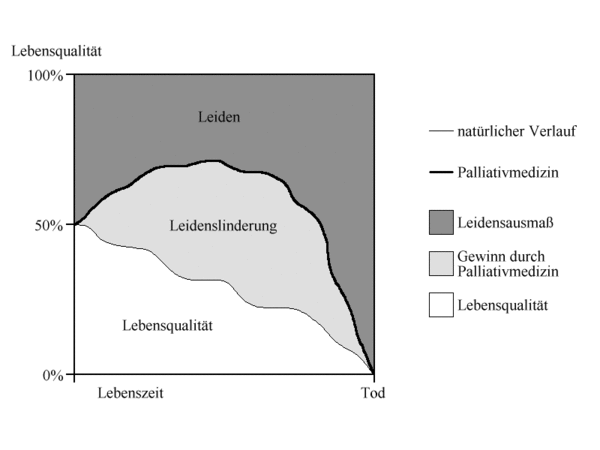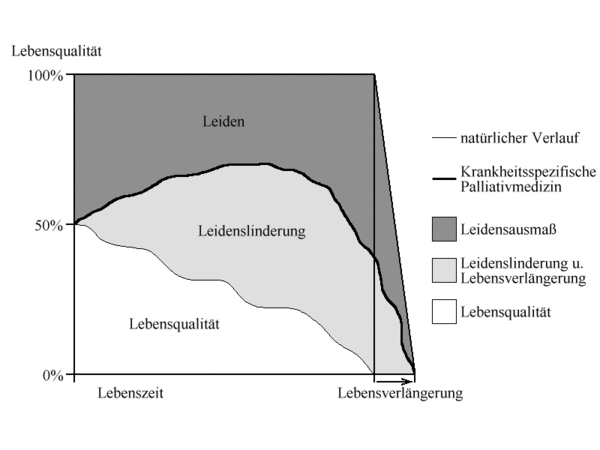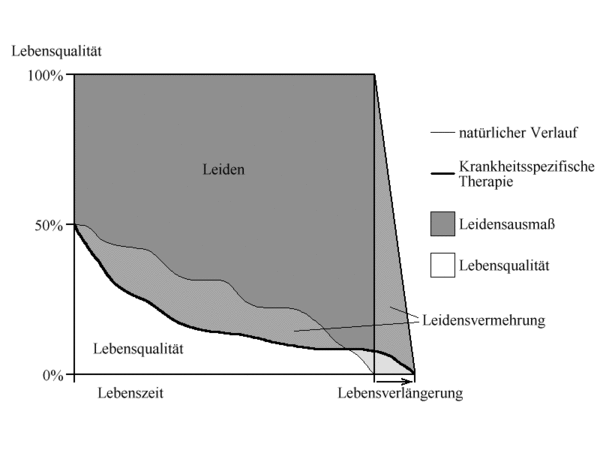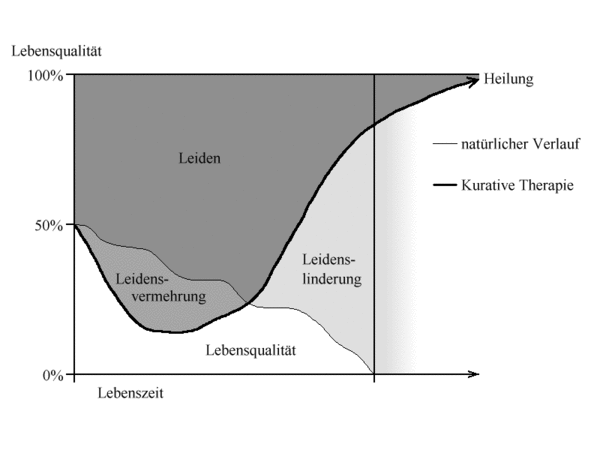Die Palliativstation im Akutkrankenhaus
Zusammenfassung
Aufgabe der Palliativmedizin ist die ganzheitliche Betreuung unheilbar Kranker, um eine Verbesserung oder die Erhaltung der Lebensqualität zu gewährleisten. Die Bedürfnisse sind zu verschiedenen Zeitpunkten der Erkrankung unterschiedlich, sodass palliativmedizinische Einrichtungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten dieser Situation gerecht werden könnten und auch die Möglichkeit einer palliativmedizinischen Notfallversorgung vorhanden sein sollte. Insgesamt ist es notwendig, Qualitätsstandards zur Verbesserung der Betreuung im palliativmedizinischen Bereich (einschließlich palliativ-onkologischer Therapien) zu erarbeiten.
Schlüsselwörter: Palliativmedizin, Leidensverlängerung, Lebensqualität, Leidenslinderung
Abstract
Palliative medicine takes care of patients with incurable diseases to maintain or improve their quality of life. The needs of patients are different, so departments of palliative medicine with different specialities, including the possibility of treating critically ill patients, should be available. It is necessary to develop standards to improve the palliative care including the palliative-oncological management.
Keywords: palliative medicine, prolonging suffering, quality of life, relieve of suffering
Einleitung
In den letzten Jahren hat sich zunehmend gezeigt, dass ein großes Defizit an Ressourcen in der Betreuung schwerst Kranker, unheilbar Kranker und sterbender Patienten besteht. Viel zu selten beschäftigen sich Ärzte mit grundsätzlichen Fragen, wie z. B.: Wann soll eine bestimmte Behandlung beendet werden? Oder: Die Fortsetzung einer Behandlung ist prinzipiell möglich, hat sie jedoch auch einen Vorteil für den Patienten oder ist nicht die Änderung der Therapiestrategie für den Patienten effektiver? Zu selten stellt sich der behandelnde Arzt die Frage nach dem Nutzen und Sinn einer Therapie oder auch einer Untersuchung1.
Viel einfacher ist es, alles Mögliche durchzuführen (in Bezug auf Therapie und Diagnostik), als wenn ein Arzt mit der Tatsache konfrontiert wird, dass das Mögliche nicht mehr zielführend ist. Daraus würde sich eine Konfliktsituation für Arzt, Pflegepersonal, alle in die Betreuung des Kranken involvierte Personen und den Patienten und die Familienangehörigen ergeben: der Arzt muss den Patienten mit der neuen Situation konfrontieren und ihm gleichzeitig die weitere Unterstützung zubilligen, den neuen Plan einer Behandlung anbieten und erläutern. Dazu benötigt der Arzt allerdings die nötige Ausbildung, die nötige Überzeugung und Zeit, um dem Patienten die geänderte Situation zu erklären und sein Vertrauen nicht zu verlieren, ihm die Hoffnung nicht zu nehmen. Der Patient braucht weiter seine Hilfe, nur mit anderen Mitteln.
Leidenslinderung und Lebensverlängerung
Die Palliativmedizin hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Patienten mit unheilbaren Krankheiten und kurzer Lebenserwartung ganzheitlich zu betreuen. Die palliativmedizinische Betreuung sollte dann beginnen, wenn die Unheilbarkeit der Erkrankung festgestellt wurde. Dabei steht die Erhaltung oder Verbesserung der Lebensqualität des Betroffenen im Mittelpunkt aller Überlegungen (Linderung und Befreiung von Symptomen) und nicht die Heilung bzw. Lebensverlängerung.
In Abb. 1 ist dieser Sachverhalt in der heute üblichen Weise graphisch dargestellt. Im Vordergrund steht die Begleitung des Patienten in seinem Leiden. Zumeist sind es Patienten mit malignen Krankheiten, die einmal im Laufe ihrer Erkrankung eine palliativmedizinische Betreuung benötigen, aber auch Patienten mit neurologischen, Nieren-, Herz-, Lungen- oder GI-Erkrankungen. Oft ist es nicht möglich eine scharfe Grenze zwischen Palliativ- und Nicht-Palliativpatient zu ziehen. In der Onkologie wird mit dem Begriff „palliative Therapie“ auch der nicht kurative tumorspezifische Therapieansatz definiert, was eigentlich den Großteil aller Patienten betrifft, die eine metastasierte Erkrankung haben. Dabei kann es zwar auch zu einer geringfügigen Lebensverlängerung kommen, der Gewinn durch Leidenslinderung überwiegt aber bei weitem (Abb. 2).
Daran erkennt man vielleicht sehr deutlich, dass die Übergänge fließend sind: denn möglich ist es sehr oft, eine Chemotherapie durchzuführen, aber wichtig ist es auch zu beurteilen, ob der Patient davon einen Vorteil hat, oder ob es nicht zielführender wäre, eine andere palliative Therapie anzubieten. Am Beispiel des metastasierten N. bronchi (NSCLC) lässt sich vielleicht die Ohnmacht der sogenannten krankheitsspezifischen Therapie erkennen: in einer Studie betrug die Ansprechrate auf die palliative Chemotherapie 28%, zum Teil mit beträchtlichen Nebenwirkungen, die mittlere Überlebenszeit ca. 9 Monate und ist damit gering besser als bei Patienten ohne Chemotherapie2. In Abb. 3 ist dieser Sachverhalt graphisch dargestellt.
Rechtfertigt ein solches Ergebnis den zwingenden Einsatz der palliativen Chemotherapie bei allen Patienten mit metastasiertem NSCLC? Hier wird eine geringfügige Lebensverlängerung mit einem beträchtlichen Verlust an Lebensqualität erkauft. Die tumorspezifische Lebensverlängerung führt also hier zu einer erheblichen Leidensvermehrung, was nicht unser ärztlicher Auftrag sein kann.
Eine vorübergehende Leidensvermehrung kann nur dann in Kauf genommen werden, wenn durch eine tumorspezifische Therapie echte Heilung bzw. eine erhebliche Lebensverlängerung mit verbesserter Lebensqualität erreicht werden kann. (Abbildung IV)
Im Krankheitsverlauf eines Palliativpatienten sind unterschiedliche Krankheitsphasen und dadurch auch unterschiedliche Bedürfnisse des Patienten gegeben. Gleich ist jedoch für alle unheilbar Kranke, unabhängig vom Stadium ihrer Erkrankung, dass das Ziel das Wohlbefinden des Patienten ist und dazu eine ganzheitliche Betreuung erforderlich ist um dem physischen (z. B. Tumorschmerz durch verschiedenste Ursachen, iatrogener Schmerz durch eine Therapie) und psychischen Schmerz (Angst, Verzweiflung, Wut, Trauer, Ungewissheit, Verlassenheit) und den sozialen Bedürfnissen gerecht zu werden: Lebensqualität kann nicht von einem anderen, sondern nur vom Kranken selbst, als eine für sein individuelles Leben wichtige Qualität erlebt werden. Eine unqualifizierte palliative Versorgung kann zu einer Verschlechterung der Lebensqualität und eventuell sogar zu einer Verkürzung des Lebens führen. Umgekehrt kann durch eine professionelle Hilfe jedoch auch einmal eine Lebensverlängerung, sicher aber eine Verbesserung des Wohlbefindens erreicht werden. Der Kranke und Sterbende hat das Recht auf Freiheit, auf persönliche Würde, auf Information, auf angemessene Behandlung, und das Recht nicht unnötig leiden zu müssen und alleine sterben zu müssen. Es ist die Aufgabe des Arztes den Patienten in jeder Phase der Erkrankung zu begleiten und den Behandlungsdruck zurückzunehmen.
Stufenplan der Palliativmedizin
In den verschiedenen Stadien der Erkrankung kommen jedoch die einzelnen Bedürfnisse des Kranken in unterschiedlicher Intensität zum Tragen. In einem frühen Krankheitsstadium wird eher die tumorspezifische (bzw. krankheitsspezifische) Therapie, im späteren Stadium die rein symptomatische Therapie und psychosoziale Betreuung im Vordergrund stehen. Dieser Tatsache kann eine Abstufung der palliativmedizinischen Betreuung mit unterschiedlichen Schwerpunkten Rechnung tragen (siehe Tabelle I).