Tugenden des Patienten
Zusammenfassung
Jeder Mensch gerät irgendwann in die Abhängigkeit des Krankseins. Dieser Beitrag geht der Frage nach, inwieweit sich dies auf das Tugendstreben auswirken kann. Es wird deutlich, dass moralische Intentionen, zu denen Tugenden befähigen, in der Krankheit anders gewichtet werden. So zeigt sich, dass die Einschränkungen des Kranken durch ein sensibel begleitetes Tugendstreben teilweise kompensiert werden können. Die Klugheit nimmt traditionsgemäß eine führende und zwischen allen anderen Tugenden integrierende Stellung ein, gefolgt von der Tapferkeit in der Konfrontation mit dem Unvermeidlichen. Der Mangel an Tugenden wie Ungerechtigkeit, Maßlosigkeit, Unaufrichtigkeit und eigennützige Begehrlichkeit dürfen von der Gesellschaft auch bei kranken Menschen aufgezeigt und behutsam korrigiert werden. Die vielfältigen Bezüge der Tugenden des Patienten zu jenen des Arztes werden herausgestellt. Eine ethische Kompetenz des Patienten wird skizziert.
Schlüsselwörter: Patiententugenden, ethische Kompetenz von Patienten, Kardinaltugenden, Vertrauen
Abstract
There is a high likelihood for everybody to fall sick. This article deals with the question of the impact of illness on one’s striving for virtue. It can be shown that moral intentions, which enable one to adopt virtues, are weighted differently in case of disease. It appears that although the scope of personal freedom is limited, it can be enhanced by gently accompanied striving for virtues. Prudence is the traditional leader of and integrator between virtues, followed by fortitude in confrontation with the inevitable. A patient’s obvious lack of virtues: being unjust, immoderate, imprudent and showing grossly exaggerated demands can be even sought to be cautiously corrected by society. The basis of ethical competence for the patient is outlined corresponding to that of the physician.
Keywords: Patient’s Virtues, Disease, Ethical Competence of Patients, Cardinal Virtues, Trust
Warum eine Patientenethik?
Ethik ist die Lehre vom richtigen Handeln. Jede menschliche Handlung hat verschiedene Dimensionen, die von Fall zu Fall verschieden gewichtet werden, wie die technische, ökonomische, auch die karitative und religiöse. Die ethische Dimension ist aber nicht eine unter vielen, sondern jene, die alle anderen Dimensionen integriert. Dies soll weiter unten an Hand der ethischen Kompetenz gezeigt werden.
Auch der Patient, der um seine Heilung bemüht ist, ist ein Handelnder, und zwar basierend auf dem unschätzbaren Wert seiner Würde, aus welcher seine Eigenverantwortlichkeit und sein Selbstbestimmungsrecht erwachsen, die immer respektiert werden müssen.
Definition von Gesundheit und Krankheit
Diese Definition hat eine wechselvolle Geschichte, beginnend mit der WHO-Definition von Gesundheit von 1947, nach welcher dieselbe „ein Zustand sei des vollständigen physischen, sozialen und psychischen Wohlbefindens und nicht allein das Freisein von Krankheit und Behinderung“. Dieser als utopisch betrachtete Idealzustand konnte unmöglich die Norm bilden, an der sich der Einzelne mit einem „Menschenrecht auf Gesundheit“ orientieren kann. Aber auch die Definition von Krankheit ist nicht einfach, schon gar nicht als reziproke Gesundheit. Tatsächlich scheint eine gewissenhafte Formulierung von „Was ist Krankheit?“ immer unbefriedigend zu bleiben. So widmet S. Sahm diesem Thema in einem rezenten Artikel drei sehr gediegene Druckseiten, um zu dem Schluss zu kommen, dass „jeder Fall anders“ sei.1 Dies erinnert an den Spruch des österreichischen Satirikers Johann Nestroy: „Es gibt so viele Krankheiten, aber nur eine G’sundheit.“
Fritz Hartmann hat zur Definition von Gesundheit beigetragen, wobei er sich der Denkweise einer Tugendethik bedient: „Gelingendes bedingtes Gesundsein: Gesund ist ein Mensch, der mit oder ohne (…) Mängel (…) alleine oder mit Hilfe anderer (Menschen) Gleichgewichte (…) findet, die ihm eine (…) Entfaltung seiner Anlagen (…) und Erreichung von Lebenszielen ermöglichen, sodass er sagen kann: Mein Leib, mein Leben, meine Krankheit, mein Sterben.“2
Die dem Patienten spezifische Struktur des Handelns
Der mit Krankheit und Leiden behaftete Mensch hebt sich von seinen gesünderen Mitbürgern ab: Er ist gezwungen, sich in erster Linie mit sich selbst zu beschäftigen, über seine Nöte und deren weitere Entwicklung nachzudenken und – im Normalfall – viel und mit vielen darüber zu sprechen. Er möchte seine Sorgen und Beklemmungen mit jemandem teilen, wobei zunehmend die Suche nach Hilfe mitschwingt. Sein „emotionaler Haushalt“ ist in Unordnung gekommen, seine freie Entscheidungsfähigkeit ist relativiert. Zumal es aber nicht genügt, wie der Frosch vor der Schlange in schreckhafter Untätigkeit zu verharren, muss diesem Zustand die Aktion folgen.
Was der Mensch als Patient sucht, ist, Hilfe, Heilung oder lediglich Linderung, mindestens aber Tröstung zu erreichen. Das ist das Ziel der Handlung. Der Patient kann dazu gewisse Präferenzen zum Ausdruck bringen, aber die medizinische Handlung lässt dazu wenig Spielraum, denn Heilung und Linderung werden sowohl vom Menschenbild wie auch von der Medizin selbst klar definiert. Der Patient muss aber im Stande sein anzugeben, was er dafür in Kauf nehmen will bzw. was er nicht bereit ist zu tolerieren. Diese Aussage ist ein Teil der Verständigung mit dem Arzt und wird eine Rolle bei der Auswahl der Mittel spielen.
Welche sind die Mittel zum Ziel? Hier kommen die Präferenzen des Patienten noch mehr zum Tragen. Zu allererst sind Experten zu suchen und zu finden, mit ihnen in einen Dialog zu treten und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dann wird der Patient versuchen, bei der Festlegung des weiteren Vorgehens diese seine Präferenzen geltend zu machen, und wird schließlich in hohem Maße an der konsequenten Umsetzung des Planes interessiert sein.
Wir können daher – zusammenfassend – von einem Prozess in mehreren Stufen sprechen:
a) Festlegung des Zieles, b) Bekanntgabe der Präferenzen, c) Festlegung der Mittel und d) Umsetzung des Therapieplanes. Gleichzeitig hat der Patient Rechte und Pflichten, aus welchen sich ganz konkrete – tugendhafte! – Haltungen ergeben.
Patient und Arzt – eine Interaktion
Eine Asymmetrie in der Arzt-Patient- Beziehung ist immer gegeben. Der Patient sucht Hilfe, der Arzt weiß, was er tun kann, er ist ja der Helfer. Das ärztliche Ethos ist allemal ein Fürsorgeethos. Der Arzt muss die Bereitschaft haben zu helfen, moralisch gesehen darf er die Hilfe nicht verweigern. Doch muss er sich ständig vor Augen halten, dass sein Gegenüber ein Mensch ist, dessen Würde und daher auch dessen Autonomie respektiert werden muss. Anderseits muss sich der Patient darüber im Klaren sein, dass seine auf vernünftigen Grundsätzen beruhende Selbstbestimmung nicht ohne den Arzt vollzogen werden kann. In der Regel wird er wohl auch dem Rat des Ärzteteams zustimmen wollen, und zwar gänzlich freiwillig und ohne zu müssen. Darin bestünde dann eine vernünftige Selbstbestimmung.
Das rechte Handeln des Patienten besteht also zunächst darin, einen Arzt auszuwählen, dem er sein Vertrauen schenken kann, wobei der Dialog offen bleiben und von beiden gesucht werden muss. Die Mitwirkung des Patienten erschöpft sich dabei keineswegs in der Pünktlichkeit z. B. der Tabletteneinnahme, sondern schließt die Rückmeldung über unerwünschte/unerwartete Nebenwirkungen, aufkommende Zweifel am Therapieziel und Vertrauenskrisen ein. Letztere können die Eigenverantwortlichkeit des Patienten soweit herausfordern, dass ein Arztwechsel zur moralischen Pflicht zu werden scheint.
Der Arzt wieder richtet sein Handeln dem Patienten gegenüber nach „competence and compassion“ aus.3 Diese steht gewissermaßen einer „competence in passion“ des Patienten gegenüber, wohl zu unterscheiden von einer „passiveness“. Der Patient hat zwar wenig Möglichkeiten, die vom Arzt gestellte Diagnose zu hinterfragen (allenfalls durch Einholung einer Zweitmeinung), doch ist die Partizipation bei der Erstellung des Therapieplanes ein zentrales Strukturmerkmal der patientenspezifischen Handlung.
Hier spielt das im Konsens definierte Therapieziel eine große Rolle: Wird eine kurative Therapie angepeilt, müssen so manche Härten (Nebenwirkungen, temporäre Einbußen an Lebensqualität etc.) er- und abgewogen werden. Wenn eine Heilung nicht möglich ist, werden – wie bei chronischen Leiden – die lindernden (palliierenden) Maßnahmen überwiegen (Schmerz-, Physio-, Verhaltenstherapie, supplementärer Sauerstoff etc.).
Wenn Patient und Arzt sich auf ein bestimmtes Vorgehen einigen konnten, ist die weitere Mitwirkung des Patienten dabei nicht optional, sondern geradezu Pflicht.4
Heute mutet es befremdlich an, dass die Wichtigkeit des Dialogs zwischen Arzt und Patient selbst bei Hippokrates nicht Allgemeingut war. Dies bedauert in der Spätantike ein Rufus von Ephesos5 (100 n Chr.) und bekennt sich zu einem dialogischen Handeln in der Medizin.6 Zwar scheint es, dass das alte, reine Fürsorgemodell, das bei Hippokrates vorrangige Bedeutung hat, schrittweise durch die Modelle des Vertrags und der Partnerschaft entwertet wird.7 Es ist aber zweifelhaft, ob deswegen die hippokratische Fürsorge entwertet werden muss, nur weil sie nicht immer mit einem „Informed Consent“ (als „Vorstufe der Autonomie des Patienten“) aufwarten kann.8 Freilich hat die wachsende Autonomie des Patienten zur Transformation des paternalistischen in ein Experten-Klienten-Verhältnis geführt: Aus „salus aegroti…“ droht ein „voluntas aegroti suprema lex“ zu werden. Damit rückt aber die Eigenverantwortlichkeit und mit ihr die Bereitschaft zur Übernahme eines Risikos näher zum Patienten und verwickelt ihn auch in ethisch relevante Entscheidungen, die ihn unter Umständen überfordern. Patient und Arzt handeln daher beide gut, wenn sie dem „informed consent“ große Bedeutung beimessen. Daraus folgert natürlich, dass es ein „informed refusal“ geben darf, wenn die Partnerschaftlichkeit nicht unvollständig bleiben soll.9 Solange der Arzt jene Fürsorge seinem Patienten gegenüber praktiziert, zu welcher ihn der hippokratische Eid verpflichtet, ist es auch am Patienten, diese im Vertrauen auf die Kompetenz, das Ethos und das Prinzip des „beneficere“ anzunehmen. Es kann vorkommen, dass kritische Patienten sich zu einer „gnädigen“ Annahme des ärztlichen Rates bequemen, die aber eine (neue) Distanz im Dialog mit dem Arzt schaffen kann.
Die Quadriga der Kardinaltugenden für Patienten
Das operative Vermögen des Menschen besteht aus der praktischen Vernunft, dem Willen, dem sinnlichen Begehren und dem Mut. Diese entsprechen jenen schon in vorplatonischer Zeit konzipierten, dann im „Symposion“ ausformulierten sogenannten Kardinaltugenden:10 Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung.
Nach der klassischen Tugendethik vervollkommnen die Tugenden das operative Vermögen des Menschen. Sie sind Fertigkeiten im Handeln und konstituieren eine zweite Natur des Menschen, gewissermaßen eine Prädisposition, das Gute mit Freude auszuführen. Die Tugenden sind damit eine Sicherung für die Handlungsqualität, wobei eine Handlung nur dann gut (tugendhaft) ist, wenn sie mit allen für die Handlung relevanten Tugenden konform geht; denn die moralischen Tugenden bilden eine Einheit.11
Die Besonderheit des Tugendstrebens beim Patienten liegt ganz offensichtlich in dessen Begrenztheit, die Lust an der Praxis der Tugenden voll ausschöpfen zu können. Das Wollen zum Ziel ist behindert, das für den Kranken in der Gesundheit und damit in der Erfüllung seiner moralischen Herausforderungen besteht: Mensch, werde, was du bist (Johannes Paul II.).
Krankheit und die Tugend der Klugheit
Dennoch kann – insbesondere bei langer Krankheit – ein Meistern des Schicksals sogar zu einer höheren Form des gelungenen Lebens beitragen.12 Die Klugheit erscheint als die Königin der Kardinaltugenden, weil sie zugleich das Binde- und Optimierungsmittel für die anderen darstellt. Nach Thomas von Aquin verbindet sie intellektuelle, moralische und übernatürliche Tugenden und setzt Beratungsfähigkeit, eigene Meinungsbildung und letztlich die gute Tat selbst voraus.
Es stellt für den Patienten ein Gebot der Klugheit dar,13 sich einen Arzt zu wählen und zu diesem ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Klugheit setzt Beratung voraus. Bei der Wahl des Arztes tut der Patient gut daran, sich von sachkundigen Personen seines familiären und freundschaftlichen Umfeldes beraten zu lassen. Schließlich muss der Patient dem Arzt seine Existenz anvertrauen, und dies kann nicht leichtfertig geschehen. Der Rat von vertrauten Personen – Verwandten und Freunden – ist als Brückefunktion sehr hilfreich für den Aufbau einer tragfähigen Vertrauensbasis.
Der kluge Patient wird sich also nicht nur auf das ärztliche und pflegerische Umfeld verlassen, sondern sich auch auf sein privates Umfeld stützen. Zumeist wird der Patient physisch oder psychisch im Stande sein, volle Entscheidungen zu treffen. Aber nur zu oft muss er getragen werden, ohne seine Autonomie aufzugeben. Da müssen Personen aus dem privaten Umfeld dieses Patienten einspringen, um ihm bei Entscheidungen beizustehen, was in keiner Weise eine Missachtung seiner Autonomie bedeutet. Der kluge Mensch berücksichtigt gewissermaßen den Ernstfall, wenn seine Entscheidungsfähigkeit geschmälert ist.
Die Klugheit, auf die Situation des Patienten gemünzt, basiert also auf der Fähigkeit, eine Information anzunehmen und im Dialog mit dem familiären und medizinischen Umfeld zu einem eigenen Standpunkt zu finden. Dieser Vorgang mündet im informed consent in die Zustimmung zu einer ärztlichen Handlung oder führt zur Reflexion, die einen Dissens und ein informed refusal zur Folge hat. Diese Art des Zugangs ermöglicht die autonome Entscheidung, die vom Arzt nach Art des liebenden Elternteils weiter begleitet werden wird: Der alte Paternalismus ist einem „Parentismus“ gewichen. Es konnte unter anderem gezeigt werden, dass bei einer solchen partizipierenden Entscheidung das bessere Wissen um die verschiedenen Aspekte der Krankheit zu einer Optimierung der Umsetzung der Behandlung selbst (adherence) und sehr wahrscheinlich zu besseren Behandlungserfolgen führt.14
Die Klugheit wird auch dazu helfen, den guten vom schlechten Ratgeber zu unterscheiden. Der Patient bettelt um Rat, und er bekommt ihn auch – so oder so. Wieder ist es die Klugheit, die ihn zum Vertrauen auf den guten Ratgeber führt und schlechte, inkompetente Ratgeber ausschließt. So ist z. B. davor zu warnen, ohne Rücksprache mit einem kompetenten Berater auf Hinweise aus dem Internet zu vertrauen.
Die Tugend der Klugheit wird – wie wir weiter unten sehen werden – ihrer Rolle als „Bindeglied der Tugenden“ (connexio virtutum) gerade dann gerecht, wenn ihre Praxis durch Unbelehrbarkeit, Begehrlichkeit, Vorurteile oder vorschnelle Entschlüsse und Misstrauen gefährdet wird.
Krankheit und die Tugend der Gerechtigkeit
Wer selbst nicht krank werden will, kann dies durch Schadensvermeidung versuchen, die meist wohlfeil zu haben ist: Gesund leben ist zumindest billiger als ungesund, wenigstens statistisch-epidemiologisch. Wenn Krankheit teurer ist als Gesundheit: Handelt also jener tugendhaft-gerecht, der die Behandlungskosten zu vermeiden hilft? Diese Überlegung veranlasst so manche Gesundheitspolitiker zu der Empfehlung, denjenigen Patienten, die vorangegangene regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen nachweisen können, gewisse Vorteile einzuräumen (Bevorzugung bei Terminwahl und Art der Unterbringung im Spital etc.). Besteht hierin nur ein Akt der Politpropaganda oder hat sich der nunmehr krank Gewordene damit tatsächlich etwas verdient?
Die Patiententugend der Gerechtigkeit spielt auch bei der Autonomie eine Rolle. Sie ermöglicht den gegenseitigen Respekt zwischen dem informierten Patienten und dem partnerschaftlichen Arzt und begegnet der Gefahr von neuen, anderen Asymmetrien im Sinne eines Patientendiktates über den Arzt. Hier wird der gerechte Patient die Informationen, Schlussfolgerungen und Vorschläge des Arztes als benevolent zu empfinden trachten, auch wenn er sie aus subjektiver Sicht zunächst hinterfragt hatte.
Der gerechte Patient bewahrt sich eine objektive Sicht für die Limitierungen seiner Betreuer. Er wird ihnen Zeichen der Überforderung nicht übel nehmen, Unpünktlichkeiten oder Versorgungsmängel nicht lange nachtragen und – aufgrund kluger, emotionsfreier Abwägung – seine Kritik an offensichtlichen Qualitätsmängeln ohne Polemik an der richtigen Stelle deponieren.
Bei der Tugend der Gerechtigkeit ist wie immer der soziale Aspekt besonders beim Spitalsaufenthalt ein integrierender Bestandteil. Sie verträgt sich daher nicht mit der gedankenlosen Belästigung von anderen Kranken und deren Besucher durch taktloses Verhalten und das Aufzwingen von Eigenbedürfnissen (Lüftung, Temperatur, Einstellung des TV-Apparates etc.). Im positiven Sinn gilt jener Patient als gerecht, der für die Anliegen und Probleme von noch schwerer Leidenden eintritt, notfalls in deren Sinn den ärztlichen oder Pflegedienst alarmiert oder nur einer Klaghaftigkeit nicht gleich aus dem Wege geht. Auch hier wird die Querverbindung zur Klugheit (Abwägung von möglichen Handlungen) sichtbar.
Gerecht handeln auch jene Personen, die selbst noch bei voller Gesundheit die Eigenverantwortlichkeit dem Sozialstaat gegenüber im Auge behalten, wenn es um Fragen der Verteilung von Ressourcen geht. Dazu kann der durchschnittliche Bürger – wenn auch nur indirekt – seinen Teil beitragen, indem er sich der Diskussion um die hohen Kosten gewisser Diagnose- und Therapieverfahren nicht entzieht (Magnetresonanz, Nierensteinzertrümmerung, Gelenksendoprothesen etc.). Bei einem selbst Betroffenen muss noch Raum für Erörterung der strengen Indikationsstellung und der Möglichkeit von Alternativen bleiben. Das beste Verfahren muss tatsächlich nicht immer das teuerste sein, und Rationalisierung (Qualitätssteigerung bei gleichen Kosten) ist alle Mal der Rationierung (Beschränkung des Umfanges der Anwendung) vorzuziehen.15 Hier kommen die Prinzipien der Verantwortung ins Spiel, die in der Eigenverantwortung, Subsidiarität und Solidarität bestehen (Leitlinie der historischen Bismarckschen Reform).16 Es gilt, die Eigenverantwortung gegenüber dem Menschenbild eines unmündigen Versicherten zu stärken (Eigeninitiative bei Primärprävention!). Subsidiarität bedeutet, dass der Staat Aufgaben und Kosten nur dann übernimmt, wenn der Einzelne überfordert ist. Das Solidarprinzip empfiehlt Beiträge zur Sozialversicherung, die je nach wirtschaftlichem Leistungsvermögen gestaffelt sind.
Der soziale Aspekt der Gerechtigkeit tritt schließlich in solch kleinen Beweisen der Umsicht und des Taktes zu Tage, wenn auch der „leichte Patient“ bei einem grippalen Infekt trachtet, die Umgebung zu schonen (Händewaschen, Gesichtsmaske, Kontakt mit Kindern und Geschwächten vermeiden etc.).
Der tugendhaft-tapfere Patient
Keine andere Tugend ist so eng mit dem Patientendasein assoziiert wie die Tapferkeit (Synonym: Starkmut, Mut, Stärke) und wird als „Gesolltes“ schon den Kindern abverlangt (von der Versorgung des aufgeschlagenen Knies bis zum Zahnarzt). Sie ist nicht einfach mit Mut (Courage), eher mit „anhaltendem Mut“ definiert.17
Die Tugend der Tapferkeit hat zwei „Stoßrichtungen“, den Angriff (aggredi) und das Standhalten (resistere). Tugendhaft wäre danach (beim Angriff) die zur Kühnheit gemilderte Verwegenheit und (beim Standhalten) die zu Gelassenheit aufgewertete Resignation. Das jeweilige Optimum ist daher kein „Mittelmaß“ zwischen Extremen, sondern das Maximum der jeweiligen Tugend. Dieses hängt zur Gänze von dem Maß an Klugheit ab, mit dem die jeweilige Tugend verbunden ist.18
Auch ist die Unterscheidung in physische und moralische Tapferkeit für einen Patienten von Relevanz, vielleicht gerade weil sie ihm so oft gleichzeitig abgefordert werden.
Die physische Tapferkeit betrifft die Konfrontation mit körperlichen Leiden, die bereits vorhanden sind (Schmerzen, Atemnot und viele andere Symptome) oder der zu erwartenden Unannehmlichkeiten (vor einem geplanten Eingriff etc.). Hier wird evident, dass vor der Tapferkeit die Furcht kommt: Ohne etwas oder sich vor etwas zu fürchten, gibt es keine Tapferkeit. Die Furcht setzt voraus, dass ein übermächtiger Gegner droht (schwere Operation, unsichere Prognose ad vitam), dem man u. U. lange standhalten muss, was – laut Thomas von Aquin – schwerer ist, als mutig „auf ein steiles Ziel“ loszugehen.19 Nach Josef Pieper „gehört es zu den fundamentalen Gegebenheiten dieser (…)Welt, daß die äußerste Kraft des Guten in der Ohnmacht sich erweist“20. Es gehört zu dieser Art der „tapferen Furcht“, dass sie das Problem so gut wie möglich rationell zu erfassen trachtet (Information, Aufbau von Sicherheiten, partizipative Entscheidung – sofern noch die Wahlmöglichkeit zwischen Alternativen im Vorgehen besteht). Hier kommt die „Furcht“ der „Ehrfurcht“ vor dem Unausweichlichen nahe und eröffnet Wege zur Gelassenheit und zum Vertrauen in die Kompetenz der Therapeuten.
Von der Furcht hebt sich deutlich die Angst ab. Wenn sie schon nicht als Symptom der Neurose schlechthin (Sigmund Freud) aufgefasst wird, so eignet ihr doch, dass sie die - oft genug nur vermeintliche – Bedrohung nicht auslotet und stattdessen Fluchttendenzen Raum gibt, bevor das Ausmaß der Gefährdung (der drohenden Unbill etc.) geklärt ist. Sicher ist auch dem Hypochonder eine Tapferkeit im Ertragen seiner Probleme nicht abzusprechen, doch fällt es intuitiv schwer, ihm den Mangel an der docilitas – Belehrbarkeit als einer Komponente der Tugend der Klugheit – einfach nachzusehen.
Die moralische Tapferkeit hat dagegen mit Standfestigkeit, Geduld, Treue, Wahrhaftigkeit und vor allem Vertrauen zu tun, z. B. wenn der Behandlungserfolg sich verzögert oder gar ausbleibt. Eine solche Haltung muss, wenn sie den Anspruch auf „tugendhaft“ erhebt, von einer Haltung der blinden Ergebenheit abgrenzbar sein. In weniger gravierenden Fällen kann das tapfere Einbekenntnis von liebgewordenen (schlechten) Gewohnheiten (Essgewohnheiten, Zigaretten- und Alkoholkonsum, Einzelheiten des Lebensstils) mindestens als „tugendverdächtig“ angesehen werden, bis zu dem Punkt, wo der Patient dem Arzt wichtige Informationen rückhaltlos anvertraut, wie strittige Selbstmedikationen (Missbrauch von Psychopharmaka, Hypnotika, Laxantien, Appetitzüglern), oder – noch viel gravierender und als „Schwäche“ schlechthin unannehmbar – Infektionskrankheiten (AIDS, Tuberkulose, Hepatitis B und C etc.), wenn ein Risiko der Übertragung besteht. Es liegt auf der Hand, dass hier das Eingeständnis meldungspflichtiger Infektionen soziale „Nachteile“ für den Betroffenen zeitigen kann (Anzeigepflicht, Isolierung, Verlust des Arbeitsplatzes, gesetzlich vorgeschriebene Zwangstherapie etc.). Jene Tapferkeit, mit der der Patient ohne Rücksicht auf persönliche Verluste seine dunklen Seiten offenlegt, ist immerhin lobenswert, wenngleich dieser Aspekt der Wahrhaftigkeit bereits einer normativ-moralischen Wertung unterliegt.
Maßhalten, auch eine Tugend des Patienten?
Nach Plato ist das rechte Maß eine Selbstkontrolle, die uns darin unterstützt, alle Herausforderungen des Lebens zu meistern.21 Wenn aber Tugenden quasi wie eine zweite Natur den Menschen konstituieren und geneigt machen, das Gute zu tun – und das noch mit Freude! –, dann wirkt Maßhalten für die leidende Kreatur fast wie Hohn. Nun kann keine Tugend einfach eingefordert werden. Was die Mäßigung betrifft, so steht sie einer a priori-Position der Stärke, dem Verfügungsrecht und der Freiheit zur Nutzung von Genüssen gegenüber und bewährt sich, wenn eben diese eingeschränkt wird. Tatsächlich kann die Akzeptanz einer Limitierung in somatischer und psychischer Hinsicht Anlass zu einer neuen, auf einem höheren Niveau liegenden Sinnfindung im Leben führen. Nicht von ungefähr spricht man vom „Über-sich-selbst-Hinauswachsen“.
Bringt uns die Frage weiter, worin ein Kranker unmäßig sein kann? Dies kann bereits der Fall sein, wenn Spitalspatienten oder Angehörige aus den Medien (Zeitung, Fernsehen) von noch unausgereiften Heilmethoden erfahren oder sich eine Überinformation aneignen, die sie aus dem Internet beziehen.22 Man ging in den USA so weit, diese „digitale Inklusion“ als wichtiges gesellschaftliches Ziel von lebenswichtiger Bedeutung herauszustreichen („national goal“, US Department of Commerce, XV). Daraus können unmäßige Forderungen nach aufwändigen und klinisch nicht indizierten Techniken resultieren. Dies wird besonders dann problematisch, wenn in der Endphase eines Kranken ohne Bedachtnahme auf den mutmaßlichen Willen des Kranken und entgegen der ärztlichen Meinung von den Angehörigen (bei bestehender Sachwalterschaft mitunter von Gerichten) lebensverlängernde, über die Palliation weit hinausgehende Maßnahmen eingefordert werden (Intensivstation, Beatmung, Dialyse etc.). Die bloße Verfügbarkeit solcher Techniken im Schwerpunkt- und Universitätsklinikum kann zweifellos einer solchen Maßlosigkeit Vorschub leisten. Hier erweist sich einmal mehr, dass die Klugheit in der Abwägung gefordert ist, wenn auf Seiten des Patienten oder seiner Angehörigen von einer Tugend des Maßes wenig zu spüren ist. Wenn schon den Ärzten übel angekreidet wird, dass sie gerne Dinge tun, weil sie stolz sind, darüber verfügen zu können, so darf es auch einen analogen Vorwurf an die Adresse der Patienten und Angehörigen geben, die darauf Ansprüche zu haben glauben.
Wenn das Leiden groß und das Schicksal drückend wird, neigt der Mensch zum Hadern – mit dem Schicksal, der Vorsehung, mit Gott. Doch heißt es schon bei Hiob, er habe mit Gott gehadert, der ihm aber bezeugte, er habe dennoch „recht geredet“23. Zweifellos ist auch Heroismus nichts Gesolltes. Ein Sich-Ergeben in das Unausweichliche zeigt die Verbindung mit Klugheit und Tapferkeit auf. Nun ist eine hochgradige Asymmetrie der Ausgangsebene zwischen dem Kranken (wie auch des besorgten Angehörigen) und den Betreuern im Sinne eines Ausnahmezustandes gegeben, der mit den üblichen gesellschaftlichen Umgangsformen nicht gemeistert werden kann. Prinzipiell muss das Behandlungsteam gewärtig sein, dass es vom Patienten oder seinen Angehörigen bewusst oder unbewusst durch übertriebene Forderungen in die Enge getrieben werden kann. In der überwiegenden Zahl der Fälle aber registrieren Ärzte und Pflegepersonen die wachsende intuitive Klugheit, welche den Patienten und seine Angehörigen zur vertrauensvollen Annahme einer kompetenten Fürsorge sowie der vielfachen Einschränkungen befähigt, die eine Krankheit zum Tode mit sich bringt.
Weniger dramatisch, aber zahlenmäßig bedeutsam ist das Maßhalten der Menschen in der primärpräventiven Lebensführung. Hier ist – wie weiter oben erwähnt – gleichermaßen die Klugheit gefordert, damit das richtige Maß gehalten werden kann: Auch Diät, Gewichtskontrolle und Sport können auf unkluge Weise zu Schaden führen, wenngleich der ebenso unkluge Gebrauch von Genussmitteln, die Gewichtszunahme und Vermeidung von Bewegung die gravierendsten Formen der Maßlosigkeit sind. „Medium est optimum“ lehrt uns Aristoteles und meint damit nicht die Mittelmäßigkeit, sondern eben die Ausgewogenheit zwischen den (gut gemeinten) Extremen, die – unter Ausnützung des freien Entschlusses – von der Klugheit erreicht werden kann.
Wenn sich ein Patient fragt, ob nicht vielleicht noch eine andere, bessere, neuere Therapie verfügbar wäre, die seinem Arzt möglicherweise nicht bekannt ist, muss er an die Einholung einer zweiten Meinung denken, bevor er der Versuchung der Neugierde erliegt und auf gut Glück herumfragt und sich an der Meinung von Nicht-Kompetenten, Scharlatanen und Besserwissern orientiert. Die Einholung einer echten second opinion ist – wiederum – ein Akt der Klugheit: Der zu befragende Arzt muss auch in den Augen des bisherigen „Arztes der Vertrauens“ eine anerkannte Kapazität sein; die lückenlose Einsicht in die vorliegenden Befunde muss ebenso gewährleistet sein wie die wechselseitige Kontaktnahme unter den Ärzten.
Enhancement
Wenn an sich gesunde Menschen aufgrund eines übersteigerten Bedürfnisses nach körperlicher Schönheit (oder was sich gemessen an gängigen Modellen als solche versteht) oder nach höheren kognitiven Fähigkeiten einer Behandlung unterziehen wollen, die das an sich „Normale“ noch verbessern soll (Optimierung), spricht man auch von Enhancement.24 Dieses Bestreben hat viele Gesichter und Quellen. Letztere reichen von der kritiklosen Annahme von fragwürdigen kosmetischen Normen bis zur neurotischen Dysmorphophobie. Hier ist festzuhalten, dass fundierte medizinische Indikationen wie Missbildungen und rekonstruktiv-chirurgische Eingriffe bei entstellenden Narben nach Unfällen oder Verbrennungen außer Streit stehen.25 Die Zahl und die vielfältige Art dieser Bestrebungen muss wohl mit dem Terminus „Begehrlichkeit“ umschrieben werden, ein Zerrbild der Mäßigung. Diese wäre wiederzugewinnen, wenn eine entsprechende Aufklärung angenommen wird (consilium), die fehlgeleitete Bedürfnisse als solche erkennen lässt (iudicium) und zur Abstandnahme umgemünzt werden kann (imperium). Hiermit soll angedeutet werden, dass die Tugend der Klugheit (siehe oben) unabdingbar mit der Wiedererlangung anderer Tugenden (hier der Mäßigung) verbunden ist.
Realistischer Weise ist es wohl utopisch zu erwarten, dass eine Frau ihren Entschluss ändert, wenn sie zur Fettabsaugung, Brustplastik, zu aufwändiger Korrektur von Gesichtsfalten oder aber zur präimplantativen Geschlechtsselektion eines IVF-Fötus entschlossen ist. Zu einer freudig gelebten Tugend des Verzichts wird man hier wohl nicht gelangen können. Dann ist es Sache verantwortungsvoller Ärzte, die Gefahrenquellen einer reinen Begehrlichkeit gegenüber tiefergreifenden Ursachen persönlicher Lebensumstände der Patientin anzusprechen und ihr das „Konsilium“ anzubieten, welches auch die behutsame Verweigerung einschließen darf.
Die ethische Kompetenz des Patienten
Für den Arzt wurden bereits notwendige ethische Kompetenzen formuliert26, basierend auf der Verbindung von fachlicher, organisatorischer, kommunikativer und ökonomischer Kompetenz. Analog dazu kann eine ethische Kompetenz des Patienten auf dessen Verantwortungsethik (partizipatorische Kompetenz), sozialer Kompetenz, kooperativer (Aufrichtigkeit, Compliance) und schließlich Präventionskompetenz (Lebensstil) gegründet sein (Abb. 1).
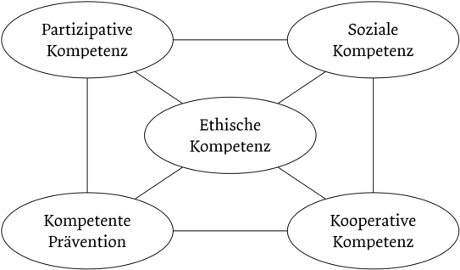
Die Dimensionen der ethischen Kompetenz beim Patienten können mit der Tugend der Klugheit unschwer verbunden werden: Partizipation setzt die Information und deren Verarbeitung voraus, welche wieder für den Lebens-Gesundheitsplan wichtige Entscheidungen zu treffen ermöglicht, die nicht nur für den Einzelnen von zentraler Bedeutung sind (gesund bleiben, gesund werden, sich mit dem chronischen Defektzustand arrangieren), sondern unweigerlich eine soziale Dimension aufweisen (Solidargemeinschaft). Letztere Forderung tritt uns leider meist durch ihr Zerrbild gegenüber, wenn der Suchtkranke (Zigaretten, Alkohol etc.) andere Personen seines engeren oder weiteren Umfelds gefährdet (Passivrauch, Verführung zum Genussmittelmissbrauch). Selbst bei der Prävention drohen Gefahren, wenn sie – wie schon erwähnt – unklug betrieben wird, d. h. wenn die rechte Mitte zwischen Übereifer und Zögerlichkeit nicht gefunden wird (unsachgemäße Trainingsmethoden, falsche Diätvorstellungen, Überbetonung der Präventivmedikation gegenüber einer Änderung des Lebensstils).
Die kooperative Kompetenz (auch als Patienten-Compliance oder Adherence an eine Therapie bekannt) wird vom Arzt am Patienten besonders hoch geschätzt. Nachweislich werden kaum alle verordneten Tabletten geschluckt, was unter Umständen mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko verbunden sein soll.27 Gründe dafür sind neben der Unterschätzung des Risikos ein mangelndes Problemerleben, die Entschuldigung mit jahrelang „ungestraftem“ Verhalten und das Dilemma der oft komplexen Maßnahmen,28 wie Zigaretten- und Alkoholentwöhnung, Diätumstellung, Ausdauertraining (und womöglich alles gleichzeitig). Hier können sich die Kompetenz der Dialogbereitschaft des Arztes mit der aufrichtigen Kooperationsbereitschaft des Patienten treffen, um individuell praktikable Kompromisse auszuarbeiten (im weniger radikalen Sinne von „eins nach dem anderen“ oder dergleichen).
Das Geschäft mit dem Risiko
Die Verantwortungsethik und die Tugend des Maßhaltens werden herausgefordert, wenn normale Lebensprozesse (z. B. Glatzenbildung), milde Symptome (Reizdarm) und gewisse Risikobefunde (Blutdruck, Cholesterin, Knochendichte etc.) hochgespielt und als bereits manifeste und lebensbedrohliche Krankheit definiert werden. Solch ein Prozess wird neuerdings mit „disease mongering“ (Hausieren mit Krankheiten) umschrieben. Durch die Weckung von Zukunftsängsten wird auf eine jahrzehntelange, teure medikamentöse Therapie gepocht, welche eher der Pharmaindustrie als den Patienten selbst von Nutzen ist.29 Der epidemiologisch registrierbare Nutzen verschiedener solcher Verfahren erscheint zwar durch die Evidence-Based Medicine abgesichert, doch kann die individuelle klinische Relevanz für den Patienten selbst auf der Strecke bleiben.30 Das Problem für den Patienten beginnt also dort, wo seine aus diversen Quellen gewonnenen Informationen (Medien, Internet) von seinem Arzt in Frage gestellt werden. Nun ist die Kompetenz zum Dialog „auf Augenhöhe“ unabdingbar, ein Appell, der an beide Partner gerichtet ist. Es kann nun an der Verantwortung des Arztes liegen, im Sinne eines „passiven Paternalismus“ mit guter Begründung von übertriebenen medikamentösen Präventionsmaßnahmen abzuraten, zumal erwiesen ist, dass eine Änderung des Lebensstils (Gewichtsreduktion, Bewegung, Zigarettenabstinenz) einen vielfach höheren Nutzeffekt zu erzielen vermag.
Der „schwierige“ gegenüber dem „idealen“ Patienten
In aller Regel stehen bei schwierigen Patienten nicht selten ein Konflikt mit dem Gesundheitssystem an sich und/oder ein Kommunikationsproblem im Vordergrund. Der schwierige Patient bedeutet für den Arzt Stress.31 Die Konfrontation zwischen Arzt und Patient scheint das Problem häufig sogar zu verschlechtern (Abwärtsspirale), wenn nicht durch eine ausgesuchte Ortwahl für das Gespräch, Ungestörtheit, Zeitwahl etc. ein optimales Milieu geschaffen wird. Der schwierige Patient wurde von J. F. Groves32 als Typ des Anklammerers, des Unverschämt-Fordernden, des Hilfeablehners und des Selbstdestruktiven klassifiziert (Mischformen nicht ausgeschlossen). Es kann für den Arzt (oft eine ganze Gruppe von Ärzten) eine Herausforderung ersten Ranges bedeuten, in vielen Gesprächen eine Dialogbasis aufzubauen, mittels derer die Umkrustung des Gemütes des Patienten für die Akzeptanz (consilium) aufgeweicht werden kann.
Der für den Arzt ideale Patient scheint in allem das Gegenteil des schwierigen zu sein,33 er strotzt und leuchtet quasi von allen Tugenden – oder nur scheinbar, weil nur aus der Sicht des Arztes beurteilt? Es kann durchaus offen bleiben, ob ein solches Idealbild nur als utopischer oder Goldstandard gelten darf, um den Ärzten bewusst zu machen, Patiententugenden nicht einfach für selbstverständlich zu nehmen, sondern sie dankbar zu würdigen.
Der Autor ist Prof. Dr. E. H. Prat für wertvolle Hinweise und Ergänzungen zu größtem Dank verpflichtet!
Referenzen
- Sahm S., Der moderne Patient und seine Ansprüche an die Medizin, Imago Hominis (2008); 15: 303-311
- Hartmann F., Kranke als Gehilfen ihrer Ärzte, Medizinische Materialien 145, Zentrum für medizinische Ethik, Bochum (2003), S. 32
- Pellegrino E. D., Thomasma D. C., The Virtues in Medical Practice, Oxford University Press, Oxford (1993), S. 79-91
- Dies geht so weit, das bei mangelnder Kooperation oder notorischer non-compliance des Patienten der Arzt berechtigt ist, den Behandlungsvertrag einseitig aufzukündigen (Marzi L. M., Vortrag bei der Österreichischen Gesellschaft für Medizinrecht, Linz, Dezember 2008).
- zitiert nach Spitzy K. H., Dämon und Hoffnung, Hasel Verlag, Wien (1993)
- Weitere Fakten zur historischen Entwicklung siehe von Engelhardt D., Von den Tugenden des Patienten, Imago Hominis (2000); 7: 115-124, S. 117
- Pöltner G., Grundkurs Medizinethik, Facultas, Wien (2002)
- Sass H. M., Informierte Zustimmung als Vorstufe zur Autonomie des Patienten, Medizinethische Materialien 78, Zentrum für medizinische Ethik, Bochum (1992)
- Pellegrino E. D., Thomas D. C., siehe Ref. 3
- Pieper J., Über die Tugenden. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß, Kösel Verlag, München (2004)
- Prat E. H., Kardinaltugenden und Kultivierung des Gewissens, Imago Hominis (2001); 8: 265-272
- siehe Pöltner G., Ref. 7
- Prat E. H., Das Autonomieprinzip aus der Perspektive des Patienten, Imago Hominis (2009); 16: 115-128
- zitiert nach Loh A. et al., Patientenbeteiligung bei medizinischen Entscheidungen: Defekte der partizipativen Entscheidungsfindung aus systematischen Reviews, Dt. Ärzteblatt (2007); 104: A1483
- Schöne-Seifert B. et al. (Hrsg.), Gerecht behandelt? Rationierung und Priorisierung im Gesundheitswesen, Mentis, Paderborn (2006)
- Fuchs C., Allokation der Mittel im Gesundheitswesen, Medizinische Materialien 94, Zentrum für medizinische Ethik, Bochum (1994)
- Pellegrino E. D., Thomasma D. C., siehe Ref. 3, S. 109
- Pieper J., Tapferkeit, in: Pieper J., siehe Ref. 10, S. 175
Jahn O., Tapferkeit als ärztliche Tugend, Imago Hominis (2001); 8: 291-295 - v. Aquin T., Summa theologica, II-II, q.123, a.6
- Pieper J., Vom Sinn der Tapferkeit, Kösel, München (1963), S. 54 f.
- Plato, Phaedo 68
- Schröder P., Vom Sprechzimmer ins Internet, Medizinische Materialien 137, Zentrum für medizinische Ethik, Bochum (2002)
- Hiob 42, 9
- Sandel M. J., Plädoyer gegen die Perfektion, Berlin University Press, Berlin (2008)
- Imago Hominis 4/2007 mit dem Schwerpunkt „Das Spiel mit dem schönen Körper“
- siehe Prat E. H., Qualitätssicherung und Tugenden im Gesundheitswesen: Begründung des Zusammenhangs, Imago Hominis (2000); 7: 199-211
- Rasmussen J. N., Chong H., Alter D. A., Relationship between Adherence to Evidence-based Pharma-Therapy and Long-term Mortality After Acute Myocardial Infarction, JAMA (2007); 297: 177-186
- Kulzer B., Das Arzt-Patienten-Gespräch in der Inneren Medizin, in: Langer T., Schnell M. W., Arzt-Patient-/Patient-Arzt-Gespräch, Hans Marseille Verlag, München (2009)
- Friebel H., Krause D., Lohman G., Meyer F. T., Verantwortungsethik, Medizinethische Materialien 155, Zentrum für medizinische Ethik, Bochum (2004), S. 37 ff.
- siehe auch Imago Hominis 4/2004 mit dem Schwerpunkt „Sinnorientierte Medizin“
- siehe auch Schwantes U., Der schwierige Patient, in: Langer T., Schnell M. W., siehe Ref. 28, S. 153-162
- Groves J. F., Taking Care of the Hateful Patient, N Engl J Med (1978); 298: 893-887
- siehe auch Geisler L., Arzt und Patient, Begegnung im Gespräch, PMI-Verlag, Frankfurt/Main (2002)
Univ.-Prof. Dr. Friedrich Kummer, IMABE
Landstraßer Hauptstraße 4/13, A-1030 Wien
fkummer(at)imabe.org







