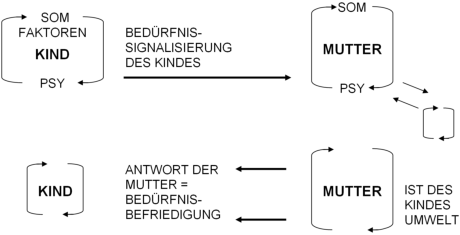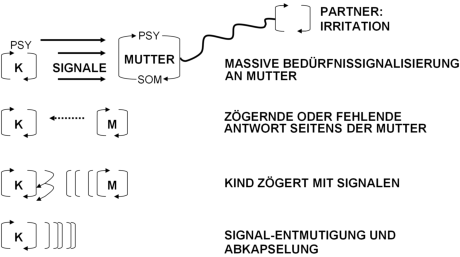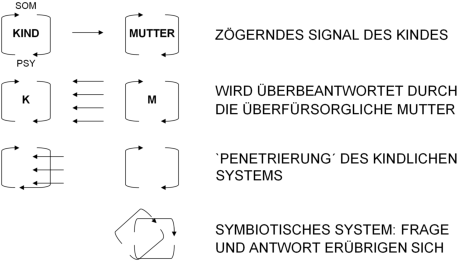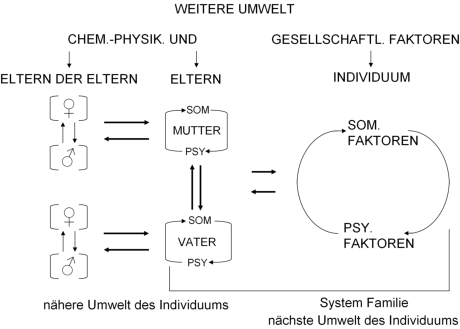Bemerkung zu fehlerhaft kommunizierenden Systemen und den Folgen
Zusammenfassung
In Diagnose und Therapie wird die Einbettung des Patienten in seiner Familie zu selten erkannt. Der Helfer (Kindergärtnerin, Lehrer, Pädiater und Allgemeinmediziner, Sozialarbeiter) ist nicht trainiert, seinen Patienten als Teil eines oder mehrerer Systeme zu sehen. Besonders im ersten Kontakt mit dem professionellen Helfer wiederholt der Patient seine frühkindlichen Interaktionsmuster. Diese fehlerhafte und pathogene Kommunikation innerhalb der Familie kann erkannt und verändert werden (Familienorientierte Allgemeinmedizin, Systemische Familientherapie). Das bis heute nicht ausreichend genutzte systemische Denken in Medizin und Medizinpolitik hat eine gesellschaftliche Veränderungspotenz.
Stichwörter: Frühkindliche psychosomatische Reaktionsmuster und Familie. Systemtheorie, dualistische, holistische und systemische Familienmedizin
Abstract
In therapy and diagnosis the aspect of the patient’s imbedding in his own family is rarely recognised. As far as the helper (nursery nurse, teacher, paediatrician and general practitioner, social worker etc.) is concerned the underlying reason is often an inability to see the patient as part of one or more systems. Especially the (patient’s) first contact with a professional helper needs to be understood as a repetition of early childhood patterns of interaction in the family system. This faulty and pathogenic communication within the family can medically be detected and changed in Family Oriented Primary Care. Hitherto not sufficiently used systemic thinking in medicine and medicine politics would prompt changes in society as a whole.
Keywords: Psychosomatic reaction patterns in early childhood and family, system theory, dualistic, holistic and systemic family medicine
Manche Begegnungen mit Leidenden sind besonders geeignet, um zu verstehen, dass Familie und Krankheit zusammenhängen und es daher lohnt, diese ursächliche Verbindung zu berücksichtigen. Die zur Erkenntnis dieser Tatsache bevorzugten Begegnungen finden in Kindergarten und Volksschule mit den jeweiligen Lehrern oder in der Konsultation beim Pädiater wegen kindlicher Beschwerden statt, später in den Sprechstunden des (Familien!-)Arztes, dem „Arzt der ersten Linie“, wegen trotz Behandlung weiter bestehender Beschwerden.
Definition Familie
Aber wer oder was ist Familie?
Familie ist ein System mehrerer, in Intimität zusammenlebender Personen mit gemeinsamer Geschichte. Zu dieser tradierten Historie gehört auch die Tatsache, dass zwei Personen, die „eine Familie gründen“ wollen, aus ganz spezifischen Ursprungsfamilien stammen, die das Paar geprägt haben und weiterhin beeinflussen werden. Insofern kann auch eine Familie nicht a-historisch, also ohne Bezug auf ihre Einbindung auf die Eltern der Eltern usw. betrachtet und verstanden werden. Oder, wie der Hausarzt F. J. A. Huygen präzisiert: „Die Familie ist keine Ansammlung von Individuen, sondern eine lebendige und entwicklungsfähige Einheit verbundener Menschen, die gemeinsame innere und äußere Bedingungen teilen.“1
Anfang der Werdung der Familie: die frühe Mutter-Kind Beziehung
Wenn das Kind das Paar zur (Klein-)Familie komplettiert, ist es nicht nur das Mischungsergebnis der körperlichen, genetisch tradierten Merkmale der Eltern. Es hat, abgesehen von der intrauterinen, also vorgeburtlichen Bindung, ab der Geburt eine Beziehung zur Mutter sowie zum Vater und anderen Beziehungspersonen. Der Anfang der Familienwerdung ist die frühe Mutter-Kind Beziehung. Diese lässt sich als zunächst dyadisches (2-Personen), nach kybernetischen Gesetzen ablaufendes Kommunikationssystem verstehen und analysieren. Dieses familiäre Ur- und Minisystem prägt des Kindes Verhalten und Gewohnheiten, bedingt aber auch seine Gesundheit und Krankheiten mit (siehe Abb. 1).
Die Mutter beantwortet die kindliche Bedürfnissignalisierung mit Trösten, Liebkosen, Wiegen, Stillen. Die mütterlichen Verhaltensweisen laufen zum Teil nach angeborenen, zum Teil nach erlernten Verhaltensmustern, nach Programmen ab: relativ ungestört, so sie angeboren, störanfällig, wo sie das Ergebnis eines von und in der Mutter-Kind/ Säugling Beziehung stattfindenden Lernens sind. Es kann beim Säugling ein frustrierender Lernverlauf mit eventuellen körperlichen Folgen (erstes kindliches psychosomatisches Reaktionsmuster2) durch eine nicht ausreichende, zögernde oder gar fehlende Reaktion auf seine massive Bedürfnissignalisierung zustande kommen (siehe Abb. 2).
Eine andere kommunikative Störungsvariante bestünde darin, dass zögernde Signale des Kindes von einer überfürsorglichen Mutter „überbeantwortet“ werden (siehe Abb. 3).
Vieles spricht dafür, dass viele auch organische Erkrankungen ihre Wurzeln in dieser höchst vulnerablen Phase der menschlichen Entwicklung haben. Zusätzlich muss davon ausgegangen werden, dass der Interaktionsstil aller späteren zwischenmenschlichen Beziehungen ihren Ursprung in der Mutter-Vater-Kind Beziehung, also in der Familie haben.
Wegen des Eingebettet-Seins des Säuglings und Kleinkindes in dieses Minisystem ist beim ersten Auftreten von Symptomen das Krankwerden, so der Helfer dies „lesen“ kann, Signal eines fehlerhaft kommunizierenden Systems. Versagt die Selbstregulation durch die Familie, so folgt meist die Fremdregulation durch eine ärztliche Intervention. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Mutter-Säugling-Beziehung schon längst zum Mutter-Vater-Kind (+ Geschwister) System entwickelt: Geburtsstunde der Familie. Bei diesem „3plus System“ spielt der Vater im Interaktionssystem eine ganz spezifische und wirksame Rolle. Mutter, Kind, Vater als System sind wiederum Subsysteme eines größeren Systems, das auch sie beeinflusst, z. B. die Beziehung der Eltern der Mutter und die des Beziehungspartners sowie dessen Interaktionen, dann die gesellschaftlichen Einflüsse usw. (siehe Abb. 4).
Dass emotionale Bedürfnisse der Frau an das Kind herangetragen werden, ist eine übrigens sehr häufige pathogene familiäre Gegebenheit, im Gegensatz zu einer Frau mit zufriedenstellender Partnerschaft.
Das Bio-psycho-soziale Modell
Abb. 4: Jeder Mensch wird von außen, also von der weiteren Umwelt (chemisch-physikalische, soziale Faktoren) und von innen, vom Aufeinanderwirken somatischer (som) und psychischer (psy) Faktoren beeinflusst. Jeder Mensch ist im System Familie (Mutter, Kind, Vater, Geschwister) eingebettet. Seine Eltern sind ebenfalls in je eine Familie integriert, die auf sie einwirkt, usw. Wird der Einzelne krank, sollte seine Symptomatik auch vom Aspekt der auf ihn Einfluss nehmenden Familie betrachtet werden. Dieses multifaktorielle, bio-psychosoziale Modell (somatische, psychische Faktoren) ist ebenso trivial wie im medizinischen Alltag ungenützt. Die Gründe dafür werden in der Analyse der Arzt-Patient Interaktion deutlich.
Aber wie steht es um den konsultierten Arzt/Ärztin, auch er/sie Sohn/Tochter einer Familie?3 Ist ihm/ihr bewusst, dass eine medizinische Intervention Teil einer heilenden Beziehung ist? Dass seine/ihre Interaktion die fehlerhaften familiären Kommunikationsmuster des Patienten zu korrigieren vermag? Und ist man dazu bereit und willens, wo einem dies im Laufe des Medizinstudiums ausgetrieben oder zumindest nicht als Thema nahe gebracht wurde? Ist der Arzt/die Ärztin bereit, die leidenschaftslose „objektive Rolle“ des Betrachters des „Objekts Patient“ („Ich weiß, was du brauchst“) zu verlassen? Ein professoraler Kollege antwortete auf die Frage nach der Arzt-Patient-Beziehung entrüstet: „Ich habe keine Beziehungen zu meinen Patienten…“ Das Missverständnis liegt hier offen zu Tage: Es gibt sie, die Medizin ohne Beziehung zum Patienten. Eine Medizin, die dem trivialen Modell der reparaturbedürftigen Maschine folgt. Eine Medizin, bei welcher der handelnde Arzt am Objekt Patient Daten sammelt, interpretiert und zur Basis seiner therapeutischen Reaktion werden lässt. Bei diesem Prozess bleibt der Arzt scheinbar aus der „Beziehung“ ausgespart, seine Person tut nichts zur Sache. Doch die Annahme des unbeteiligt Bleibens des Arztes stimmt schon bei den ersten Schritten des Datensammelns und Interpretierens nicht mehr, denn es erfahren die vom Patienten gegebenen Informationen eine sehr persönliche, durch Biographie, Sozialisation etc. des Arztes beeinflusste Auswahl. Einstein weist zu Recht darauf hin, dass es unsere Theorien seien, die darüber bestimmen, was wir sehen und beschreiben.4
Über das Fehlen ganzheitlichen und systemischen Denkens in der Medizin
Lässt sich eine retrograde Entwicklung der westlichen Medizin von einer ganzheitlichen humoralen zu einer cartesianisch-dualistischen Medizin feststellen?
Als die Medizin im 19. Jahrhundert den Weg der Naturwissenschaft einschlug, folgte eine lange Periode eines kartesianischen Dualismus und dessen Metaphysik, die bedauerlicherweise bis heute andauert. In unserer medizinischen Ausbildung, die ja leider einer „deformation professionelle“ gleichkommt, blieben die meisten Mediziner in den die Struktur als krankheitserzeugende Ursache (Galen, Morgani, Virchow) erklärenden Modellen, stecken. Nennen wir also diese Mediziner einmal der Einfachheit halber Strukturalisten. Im Gefolge davon entstand das Paradigma der Maschine als Erklärung für Lebensvorgänge und Krankheitsentstehung. Deren Reparateure: Die Iatromechaniker. Die Konsequenzen des Maschinenparadigmas prägen den Körperbegriff der so genannten modernen Medizin. Das Maschinenparadigma hat zwar die Entwicklung einer erfolgreich übertechnisierten Medizin gefördert; es versagt aber an zwei entscheidenden Punkten:
- Es reicht nicht aus, um Körpervorgänge als spezifische Lebensphänomene zu beschreiben.
- Es kann nicht psychische und soziale Faktoren mit Körpervorgängen in Verbindung bringen.
Familie und Krankheit
Als Basis dessen, was zwischen Arzt und Patient geschieht, hat das familiäre Minisystem der frühen Mutter-Kind-Beziehung, die auch die Präsenz des Vaters inkludiert, zu gelten.
Hypothese 1
Die Geburtsstunde der Familie ist lange vor der Geburt anzusetzen; die prä- und postnatale Beziehung aber muss als grundlegende prägende Kraft in den Entwicklungsprozessen des Säuglings gesehen werden. Es kann und wird auch in der Mehrzahl ärztlicher Interventionen der Kranke isoliert betrachtet und behandelt werden. Aber auch in den nicht offensichtlich kranken und/oder krankmachenden Familien erweist es sich als zweckmäßig, den einzelnen Patienten in seiner familiären Einbettung zu berücksichtigen.
Hypothese 2
Patienten haben Familien („Patients have families“ betitelte 1948 Richardson seinen Bericht zur Gesundheitsversorgung von Familien in den USA5), und diese beeinflussen das Gesundheits- und Krankheitsverhalten des Patienten ebenso wie ihre Kooperation (compliance!) die Behandlung ihrer Krankheiten. Hat der in Hypothese 1 und 2 für Gesundheit und Krankheit so wesentliche Aspekt der Beziehung (interaktioneller Aspekt) im Verständnis (sowohl beim leidenden Patienten als auch beim behandelnden Arzt) der Krankheitsentstehung, des Verlaufs und der Behandlung Eingang gefunden? Wenn das nicht der Fall ist, sind folgende Störungen zu erwarten:
a) Von Seiten des Patienten:
- Er weiß nicht, was ihn krank macht.
- Daher kann er nicht sagen, was er braucht.
- Klarerweise bekommt er nicht, was er braucht, um gesund zu werden.
b) Von Seiten des Mediziners:
- Er glaubt zu wissen, was den Kranken krank macht.
- Er meint, dem Patienten klar zu sagen, was dieser braucht.
- Er gibt es ihm, nur nützt es dem Patienten nichts, dieser kann es nicht gebrauchen.
Es kann davon ausgegangen werden, dass der Patient die ihn krankmachende Traumatisierung, die familiären pathogenen Kommunikationsstrukturen in der Interaktion mit dem Mediziner „re-inszeniert“, und zwar um so stärker, je bedeutender psychische und soziale Faktoren an seinem Krankwerden mitbeteiligt waren. Er „überträgt“ den früh erlebten und krankmachenden Kommunikationsstil auf den Arzt in der Konsultationssituation.
Ist diese Re-Inszenierung nützlich?
Hypothese 3
Der Patient kann durch sie erfahren, was ihn krank macht und –
Hypothese 4
Der Mediziner kann es vom Patienten erfahren.
Hypothesen 3 und 4 setzen freilich voraus, dass der Mediziner systemisch, psychosomatisch und familienbezogen denkt und handelt.
Dazu notwendig sind:
- ein Wissen über den Leib-Seele-Zusammenhang zu besitzen, d. h. zu verstehen, nach welchen, auch systemischen Gesetzmäßigkeiten, psycho-physische Phänomene ablaufen (psychosomatische und psychodynamische Basics);
- dieses zunächst theoretische Wissen auf der Basis eigener Betroffenheit selbst sinnlich und bewusst zu erleben;
- aus diesem ganzheitlichen Erlebnis dem Patienten als einmalige, unteilbare Person in einer dialogischen Beziehung zu begegnen.
In diesen drei Punkten ist subsumiert, was einen Arzt im Winnicot’schen Sinne zu einer „good enough mother“ – einer ausreichend guten Mutter – macht, nämlich zuhören, verstehen und reagieren, womit wir wieder im familiären, jetzt aber heilenden Kontext der Familie angelangt sind.
An den frühen körperlichen Störungen des Säuglings, so sie nicht organisch bedingt sind, zeigen sich unmittelbare Reaktionen auf eine gestörte familiäre Struktur und Kommunikation. Der Vater als Familienmitglied wirkt auf diese Beziehung durch seine Interaktion auf seine Frau, die Kindesmutter (dazu aus der systemischen Familienmedizin: „Do you want to make your children happy? Make your wife happy!“).
Der Wechsel vom intra- zum extrauterinen Dasein zwingt die Mutter-Kind Symbiose zu neuen Kommunikationsmitteln. Der Säugling befindet sich bis etwa zum dritten Lebensmonat noch in der Symbiose, während die Mutter schon aus einer Ich-Du-Beziehung fühlt und handelt. In dieser frühen Mutter-Kind-Beziehung prägt ein dichter Kommunikationsprozess grundlegend bleibende vegetative Schablonen, psychische Erlebnisweisen (Lust, Unlust), sowie soziales Verhalten (Ermutigung, Mut, sozialer Beitrag bzw. Entmutigung, Minderwertigkeitsgefühl, Neurotisierung;6 Urvertrauen;7 siehe Tab. 1).
| Einstellung(en) der Mutter | Krankheit des Säuglings |
|---|---|
| Teilentzug affektiver Zuwendung | anaklitische Depression |
| Völliger Entzug | Marasmus |
| Unverhüllte Ablehnung | Neugeborenenkoma |
| ängstliche übertriebene Besorgnis | Dreimonatskolik |
| Feindseligkeit in Form von Ängstlichkeit | Neugeborenendermatitis |
| Wechsel zwischen Verwöhnung und Feindseligkeit | Hypermobilität (Schaukeln) |
Spitz, ein früher Beobachter und Filmer der Mutter-Kind-Beziehung in ihrer potenziellen Pathogenität, korrelierte defizitäre mütterliche Haltungen mit psychophysischen Störungen des Säuglings. Diese übrigens sehr häufigen frühen psychosomatischen Reaktionsmuster reichen von dermatologischen und gastrointestinalen Funktionsstörungen (ICD-10 F45.3 somatoforme autonome, also über das Vegetativum laufende Störungen) über F9 (Verhaltens- und emotionelle Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend) bis zu F54 (psychische Faktoren und Verhaltenseinflüsse bei andernorts klassifizierten Erkrankungen). In der ICD-10 Kodierung F54 finden sich für den psychosomatisch Informierten, nicht aber für den noch unkundigen Studierenden verständlich, die im ICD-9 noch als psychosomatische Erkrankungen mit histologischer Substratschädigung bezeichneten Erkrankungen (im Unterschied zu den körperlichen Funktionsstörungen psychischen Ursprungs), die als die „holy seven“ apostrophiert wurden (atopische Neurodermatitis, Ekzem, Urticaria, Ulcus ventriculi et duodeni, Colitis ulcerosa).
Eingangs wurden zwei konträre pathogene Kommunikationsstile beschrieben: Die Über- und die Mangelbeantwortung der Säuglingssignale. So wie der Säugling nicht isoliert betrachtet werden kann („There is no such thing as a baby“, unterstrich Winnicott diese Mutter-Kind-Einheit), so kann ebenso die Mutter nicht getrennt von ihrem Interaktionspartner, dem Säugling, verstanden werden. Beide, will man der Gesundheit erhaltenden und Krankheit erzeugenden Realität gerecht werden, müssen unter dem Aspekt der Familie und ihrer Interaktionen analysiert werden. Nur so kann das Odium der „allein krankmachenden Mutter“ und die lange als „Mutterneurosen“ überschriebenen frühen Störungen beseitigt werden. Können doch jene defizitär interagierenden Mütter sicher nicht ohne familiären Bezug, nicht ohne Berücksichtigung der Beziehung der beiden Eltern des krank werdenden Kindes verstanden werden. Hier könnten systemische Ansätze entscheidend Klärung schaffen.
Die kranke Familie und ihre Behandlung: die Familienmedizin
Auch Ärzte, die den Ausdruck Familienmedizin nie gehört haben, wissen, dass ihre Patienten zwar wegen eines oder mehrerer Symptome kommen, zugleich aber ihr soziales Umfeld, insbesondere ihre Familie zur Sprechstunde mitbringen.
Nachdem der Arzt M. Balint in „Der Arzt, der Patient und die Krankheit“ 1964 beschrieb, wie die Beziehung zwischen Arzt und Patient den Verlauf einer Erkrankung beeinflusst,8 war es besonders für den Allgemeinmediziner („Familiendoktor“) naheliegend, den dritten Faktor, nämlich das familiäre Umfeld in die medizinische Diagnostik und Therapie einzubeziehen. Da die Familie ein System ist, also eine Gruppe von Menschen, die als funktionales Ganzes interagieren, mussten die Grundideen des systemischen Denkens in die allgemeinmedizinische Forschung integriert werden. Dies geschah in den USA mit den Anfängen der Systemischen Familientherapie (Minuchin9 und Mental Research Institute Palo Alto), in Deutschland etwa ab H. E. Richters „Patient Familie“ (1971)10.
Die Wiener Psychosomatische Abteilung (Gründung Hoff/Ringel) wurde von Anfang an und vom Auftrag her (Psychotherapeutische Behandlung psychosomatischer Erkrankungen und Essstörungen) mit der Frage konfrontiert: Was macht in der Familie den Einzelnen krank? Diese Frage ist dem multifaktoriellen, biopsychosozialen Modell (siehe Abb. 4) und dem in diesem impliziten systemischen Denken verpflichtet. Man denke einfach an die junge Frau mit anorektischem Verhalten (früher: Patientin mit Anorexia nervosa; oder: „Die Anorektikerin“), die bei offensichtlich gestörter Familienbeziehung „Symptomträgerin“ und damit „Stabilisiererin" der kranken Familie ist (eine ähnliche Patientin unserer Station: „In dieser Familie zahlt es sich nicht aus, Frau zu sein.“). Aber: Wird der zukünftige Arzt im systemischen, ganzheitlichen, psychosomatischen Denken und Handeln trainiert? Die „Psychosomatik“ ist in aller Munde – um auch dort zu verbleiben. Richtete sich der Aus- und Fortbildungswille der Psychosomatiker, leider nicht im Studium vorgesehen, postgradual (Gathmann/Springer-Kremser et al. 1987 bis heute) in den Diplomlehrgängen für Psychosoziale und Psychosomatische Medizin an alle Ärzte, blieb doch der Praktiker, der Allgemeinmediziner, wegen seiner privilegierten Stellung als „Familienarzt“ bevorzugter Ansprechpartner und auch Ausgang für systemische, familienmedizinische Aktivitäten.11
Grosse Hoffnungen setzten die „familienorientierten Psychosomatiker“ in das neue Medizincurriculum Wien (Block 20 „Psychische Funktionen in Gesundheit und Krankheit"). Hier sind zwar in „Psychotherapeutische Grundlagen und Anwendungen“ die systemischen, familienmedizinischen Basics enthalten,12 der Autor bezweifelt aber, dass diese in einer 50-minütigen Vorlesung dem Studenten vermittelt werden können.13 Bleibt dann noch der Arbeitskreis Familienmedizin14, in dem so grundlegende Werkzeuge wie die Erstellung eines Genogramms (Familienstammbaum über drei Generationen, alle hier stattfindenden Haltungen, auch pathogene, von Eltern auf Kinder weiter gegebene Kommunikationsstile u. v. a. m.) vermittelt werden.15
Prophylaktische Vorschläge zur Beitragspflicht des Einzelnen und der Gemeinschaft
Wenn ich eingangs bemerkte, dass manche Schnittstellen zwischen Leidenden und Helfern die Zusammenhänge Familie und Krankheit besonders grell beleuchten, so sind auch deren Akteure die Hoffnungsträger für eine dringlich notwendige Veränderung. Die hauptsächlich von unbearbeiteten familiären Spannungen ausgelöste und aufrecht erhaltene Störung wird als Hilfeappell von Kindergärtnerinnen, VolksschullehrerInnen und eben ÄrztInnen zuerst wahrgenommen. An erster Stelle kommen natürlich die Mütter, und – last but not least – die Gesundheitspolitiker, in den letzten Jahren zunehmend Frauen und immer öfter spezifisch Familienministerinnen!
Gesundheitspolitik:
Zum „Mutter-Kind-Pass“ (Einführung in Österreich 1974) schlug der Autor der damaligen Gesundheitsministerin Ingrid Leodolter (1972 – 1979) vor, die mit dem Erhalt dieses Passes verbundenen Kontakte (Vater häufig dabei!) zur Vermittlung „pychosomatischer Basics“ zu nützen. In der Zeit, in der das Kind erwartet wird (man denke an alle Vorbereitungen, Zimmer, Wäsche etc.), wären Eltern auch für eine prophylaktisch unschätzbar wertvolle psychosomatisch-familienbezogene Basisinformation offen und zugänglich. Hier könnte (Elternpass?!) die Grundlage einer gesünder kommunizierenden und Krankheit verhindernden Familie geschaffen werden.
Mediziner-Ausbildung:
In der defizitären Ausbildung der Mediziner liegt der behebbare Grund der „kranken“ Ärzte, „kranken Häuser“ und der Krise einer immer unleistbareren Medizin. Abgesehen davon, dass die Aufnahmsprüfungen eine fragliche Auslese bewirken, findet danach eine Überfrachtung in Teildisziplinen statt, mit gleichzeitigem Fehlen des Kennenlernens des Patienten als Person und seiner Krankheit als Gesamtphänomen.
Ganz entscheidend aber ist ein fehlendes Training im Reflexionsvermögen des werdenden Mediziners, der weder für die meist biographisch vorhandenen Emotionen zum eigenen Krankwerden und Sterben re-sensibilisiert, noch in der Wahrnehmung und Kontrolle seiner Gefühle gegenüber seinen Patienten geschult wird. Durch die Korrektur oben genannter Mängel könnte eine Basis für ein verbessertes Lebensqualitäts-Management nicht nur des Patienten, sondern auch des Mediziners geschaffen werden. Denn die bei Medizinern üblich überhöhten, idealisierten Selbst- und Leistungsansprüche sind ebenso wenig unbeeinflussbares Schicksal wie Unreflektiertheit, mangelnde Empathie oder fehlende Sozialkompetenz.16 Dazu muss eine grundlegende Kompetenz in systemischem Denken gelten.
So könnte eine die Familie berücksichtigende Psychosomatik als ganzheitliche Haltung, Lehre und Forschungsrichtung eine Medizin der Person, eine sprechende, eine Beziehungsmedizin werden. In einer solchen Medizin ist der Arzt nicht mehr frustrierter und letztlich wirkungsloser mechanisierter Ausführender spezialisierter Dienstleistungen einer Reparaturmedizin, sondern betroffener, dialogischer Partner des Patienten.
Dieser Artikel ist H. Scheidinger & H. J. Fuchs gewidmet.
Referenzen
- Huygen F. J. A., Family Medicine, Brunner/Mazel, Den Haag (1982)
- Gathmann P., Pathologie des psychosomatischen Reaktionsmusters, Springer, Wien (1990)
- Gathmann P., Semrau-Lininger C., Der Verwundete Arzt. Ein Psychogramm des Heilberufes, Kösel, München (1996)
- Einstein A., Infeld L., The Evolution of Physics, Simon and Schuster, New York (1938)
- Richardson H. B., Patients have families, Common Wealth Found, New York (1948)
- Adler A., Über den nervösen Charakter, 4. Auflage, Bergmann, München (1928)
- nach Erikson E. H., Kindheit und Gesellschaft, Ernst Klett, Stuttgart (1961) etc.
- Balint M., Der Arzt, sein Patient und die Krankheit, Klett-Cotta, Stuttgart (1980)
- Minuchin S., Psychosomatische Krankheiten in der Familie, Klett Cotta, Stuttgart (1991)
- Richter H. E., Patient Familie, Rowohlt, Reinbek (1970)
- Fuchs H.-J., Ärztliche Konsultation und Patientenfeedback; Fuchs H.-J., Krankheit & Familie; Hoffmann D., Hausärzte und systemische Familientherapie; Degn B., Der Patient und sein familiärer Hintergrund. Grundbegriffe der Systemischen Familienmedizin; alle in: Fuchs H.-J. (Hrsg.), Wege zur Patientenorientierten Medizin, ÖÄK-Verlag Wien (2002)
- Scheidinger H., Systemische Schulen, in: Springer-Kremser M. et al. (Hrsg.), Psychische Funktionen in Gesundheit und Krankheit, 4. Auflage, Facultas, Wien (2007)
- Scheidinger in mündlicher Mitteilung: „kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.“
- Fuchs H.-J., siehe Ref. 11
Hoffmann D., siehe Ref. 11 - Hoffmann D., siehe Ref. 11
- Gathmann P., Semrau-Lininger C., siehe Ref. 3
Weiterführende Literatur
- Bertalanffy L. v., General System Theory, George Braziller, New York (1968)
- Gathmann P., Das CGS-System und die ärztliche Alexithymie, Vortrag vor der Berufungskommission Planstelle e. O. Univ.-Prof. für Tiefenpsychologie und Psychotherapie der Universitätsklinik Wien, 1997
- Gathmann P., Vom gefährlichen Fehlen der Systemtheorie in der Medizin, in: Edlinger K., Fleck B., Feigl W. (Hrsg.), Interdisziplinäres Symposium der Österr. Gesellschaft für Organismisch-systemische Forschung und Theorie. Symposiumsband, Peter Lang, Wien (1999)
- Hamm H., Familienmedizin- als Wissensgebiet neu zu entdecken, in: Fortschritte der Medizin (1997); 12
- Hegemann T. H., Asen E., Tomson P., Familienmedizin für die Praxis, Schattauer, Stuttgart (2000)
- Klussmann R., Psychosomatische Medizin, Springer, Berlin, Heidelberg, New York (1992)
- McGoldrick M., Gerson R., Genogramme in der Familienberatung, Hans Huber, Bern (1990)
- Medawar P .B., Medawar J. S., The Life Science, Harper and Row, New York (1977)
- Schiepek G., Die Grundlagen der Systemischen Therapie, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (1999)
- Spitz R. A., Vom Säugling zum Kleinkind. Naturgeschichte der Mutter-Kind Beziehung im ersten Lebensjahr, Klett, Stuttgart (1965)
- von Uexküll T., Psychosomatische Medizin. Modelle ärztlichen Denkens und Handelns, Urban und Fischer, 3. Auflage, Urban & Schwarzenberg, München, Wien (1985) und 6. Auflage Urban & Fischer, München, Jena (2002)
- Wiener Curriculum & Diplomlehrgang für Psychosoziale & Psychosomatische Medizin, 1986 bis heute www.psychosomatic.at
- Wittgenstein L., Philosophische Untersuchungen, Suhrkamp, Frankfurt (1967)
- Winnicott D. W., Reifungsprozesse und fördernde Umwelt, Kindler, München (1974)
Univ.-Prof. Dr. Peter Gathmann
Österreichische Gesellschaft für Klinische Psychosomatik, Klinische Psychotherapie sowie Liaison und Konsultation
Leschetitzkygasse 50, A-1180 Wien
pg18(at)aon.at