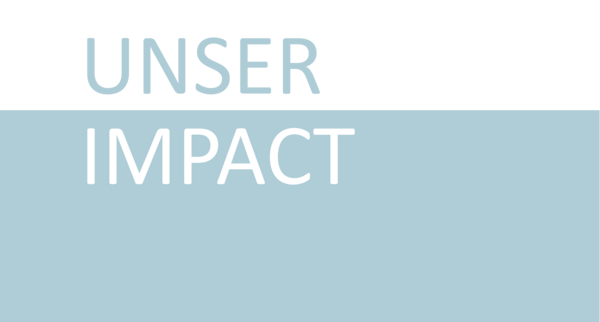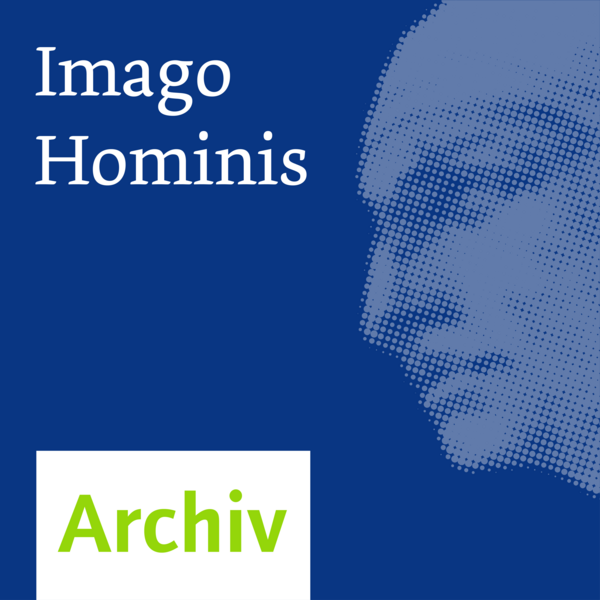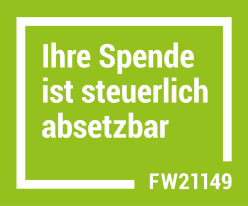Am 10. Oktober wird weltweit der World Mental Health Day begangen, ein Anlass, der die Bedeutung psychischer Gesundheit ins öffentliche Bewusstsein rücken soll. Die möglichen psychischen Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs sind bislang selten Teil der öffentlichen Diskussion.
Laut WHO werden jährlich 73 Millionen Schwangerschaftsabbrüche weltweit durchgeführt. Ob und welche Folgen damit für die psychische Gesundheit von Frauen in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Forschung. Ein Team von Wissenschaftlern aus Québec hat nun im Journal of Psychiatric Research (2025) eine bevölkerungsbasierte Studie zur Frage veröffentlicht, ob Schwangerschaftsabbrüche auch langfristige psychische Gesundheitsrisiken in Zusammenhang stehen.
Kanadische Großstudie untersucht Langzeitfolgen
Ziel war es herauszufinden, ob Frauen nach einer Abtreibung häufiger wegen schwerer psychiatrischer Erkrankungen in Krankenhaus eingewiesen wurden als Frauen, deren Schwangerschaften mit einer Geburt endeten. Dafür wurden die Daten von über 1,2 Millionen Schwangerschaften ausgewertet, die zwischen 2006 und 2022 in Québec erfasst wurden. Darunter waren 28.721 Abtreibungen und 1.228.807 Geburten (auch Totgeburten). Die Frauen wurden mit Hilfe von Krankenhausdaten bis zu 17 Jahre nach ihrer Schwangerschaft nachverfolgt.
Deutlich erhöhte Hospitalisierungsraten nach Abtreibungen
Die Ergebnisse der Studie lauten: Psychische Gesundheitsprobleme – darunter psychiatrische Erkrankungen (z. B. Depression, Angststörungen, Essstörungen), Substanzgebrauchsstörungen und Suizidversuche – traten nach Abtreibungen häufiger auf als nach Geburten. Besonders auffällig war der Missbrauch von Halluzinogenen und Kokain. Insgesamt war die Hospitalisierungsrate nach einer Abtreibung 2,5-mal so hoch wie nach einer Geburt (104,0 vs. 42,0 pro 10.000 Personenjahre).
Junge und psychisch vorbelastete Frauen sind gefährdeter
Erhöhte Hospitalisierungsraten fanden sich besonders bei Frauen, die bei der Abtreibung 25 Jahre alt oder jünger waren, die wiederholt abgetrieben hatten oder die bereits eine Lebendgeburt hinter sich hatten. Am deutlichsten zeigte sich der Unterschied bei Patientinnen mit psychischen Vorerkrankungen: Sie wurden nach einer Abtreibung rund 9-mal so oft in ein Krankenhaus eingewiesen wie Frauen ohne Abtreibung. Damit weisen Frauen mit bereits bestehenden psychiatrischen Erkrankungen das höchste Risiko für spätere psychische Gesundheitsschäden nach einer Abtreibung auf.
Methodische Stärken durch große Stichprobe und Langzeitbeobachtung
Die kanadische Studie zeichnet sich durch ihre außergewöhnlich große Stichprobe und lange Nachverfolgungszeit aus, die deutlich umfangreicher ist als bisherige Untersuchungen zu diesem Thema. Durch die bevölkerungsbasierten Krankenhausdaten aus ganz Québec und objektive Endpunkte wie psychiatrische Klinikeinweisungen liefert sie besonders aussagekräftige Langzeitdaten. Somit wird ein besserer Einblick in die langfristige Verfassung der Frauen ermöglicht.
Langzeiteffekte bleiben auch nach 17 Jahren messbar
Das Risiko für eine Spitalseinweisung wegen psychischer Gesundheitsprobleme war am höchsten innerhalb der ersten fünf Jahre nach dem Schwangerschaftsabbruch, insbesondere bei Substanzstörungen und Suizidversuchen.
Das Gesamtrisiko im Verlauf von 17 Jahren näherte sich dem Niveau nach Geburten an, blieb aber bis zum Ende der Beobachtungszeit um etwa 30 Prozent erhöht. Vor allem das Risiko für Substanzstörungen blieb langfristig signifikant erhöht. Die Forscher schließen: „Auch 17 Jahre nach Abtreibung blieb das Risiko für psychiatrische Hospitalisierung in unserer Studie erhöht.“
Rechtliche Grundlage beruht auf unbelegter Annahme
Die Frage nach den psychischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen ist eines der kontroversesten Themen der Medizinforschung. Ein sachlicher wissenschaftlicher Diskurs wird durch die emotionale Aufladung erschwert Das vorherrschende Narrativ besagt: Abtreibung schütze die seelische Gesundheit bei ungewollter Schwangerschaft, während das Austragen eines ungewollten Kindes die Psyche einer Frau massiv belaste.
Diese Annahme spiegelt sich direkt in der Rechtslage wider: In Österreich, Deutschland und der Schweiz sind Spätabtreibungen bis zur Geburt erlaubt, wenn ärztlich attestiert werden kann, dass sie zum Abwenden eines „schweren Schadens für die körperliche oder seelisch Gesundheit“ (Österreich StGB § (1) 2) erforderlich sind.
Großbritannien: 98 Prozent aller Abtreibungen mit „psychischer Indikation“
Der Gesetzgeber stuft den Schwangerschaftsabbruch damit als therapeutisches Mittel zum Schutz der psychischen Gesundheit ein. Völlig unklar ist allerdings, auf welche evidenzbasierten Daten sich diese Bewertung stützt. In Großbritannien wurden 2021 98 Prozent der knapp 230.000 Abtreibungen mit der Indikation „Gefahr für die psychische Gesundheit“ durchgeführt.
Deutsche ELSA-Studie sieht keinen Hinweis auf psychische Belastungen
Die deutsche ELSA-Studie stützt diese Position und behauptet kategorisch, dass Schwangerschaftsabbrüche keinen langfristigen Einfluss auf die psychische Gesundheit der Frau hätten und es keine Hinweise auf gravierende negative Folgen gäbe. In der aktuellen ELSA-Studie (2025) heißt es: „Ob eine ungewollte Schwangerschaft ausgetragen oder abgebrochen wird, hat längerfristig keinen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden.”
Positive Wirkung von Abtreibung auf die Psyche ist ohne Evidenz
Die aktuelle Forschungslage ist jedoch keineswegs so eindeutig, wie diese Position suggeriert. Zahlreiche methodisch hochwertige Studien belegen, dass Abtreibungen langfristig mit erhöhten Risiken für psychische Probleme einhergehen. Das trifft besonders auf junge oder psychisch vorbelastet Frauen zu.
Die 2023 veröffentlichte IMABE-Studie untersuchte 14 relevante Übersichtsarbeiten und Einzelstudien in diesem Forschungsfeld. Ihr Ergebnis: Die Hypothese, wonach eine Abtreibung einen positiven Effekt auf die Psyche der Frau habe, lässt sich durch keine einzigen wissenschaftlichen Beweise stützen. Im Gegenteil: qualitativ hochwertige Studien kommen zu dem Schluss, dass Abtreibung statistisch gesehen mit einem erhöhten Risiko für Alkohol- und Drogenmissbrauch, Suizide und Suizidversuche, Sucht, Depression und Angstzustände verbunden ist. (Bioethik aktuell, 03.07.2023) Die Autoren der IMABE-Studie betonen gleichzeitig, dass sich ein kausaler Zusammenhang prinzipiell nicht nachweisen lässt, da das entsprechende Studiendesign (Doppelblind-Studie) in dieser Frage nicht durchführbar ist.
Statistisch signifikante Korrelationen nicht von der Hand zu weisen
Allerdings weisen qualitative Studien auf signifikante Korrelationen mit bestimmten psychischen Gesundheitsproblemen nach Abtreibungen hin. Diese statistisch signifikanten Unterschiede des langfristigen psychischen Wohlbefindens zwischen Frauen mit und ohne Abtreibungsgeschichte sollten nicht bei Seite geschoben werden. Diese Erkenntnisse sind für eine umfassende wissenschaftlichen Debatte wertvoll und sollten, um das Wohl der betroffenen Frauen sicherzustellen, auch in der Politik Gehör finden.
Frauen haben Recht auf umfassende Aufklärung und Begleitung
Frauen haben ein Recht auf eine vollständige Aufklärung über die möglichen Risiken eines Schwangerschaftsabbruchs. Um sie in einer besonders herausfordernden Lebenssituation bestmöglich zu unterstützen, braucht es sowohl umfassende Information als auch einen sicheren Zugang zu Alternativen. Eine Entscheidung für eine Abtreibung ist nie einfach und kann Frauen auch noch lange danach belasten. Daher sollte der Zugang zu therapeutischer Nachbetreuung sichergestellt werden. Die Erfahrungen von Frauen dürfen dabei weder marginalisiert noch tabuisiert werden.